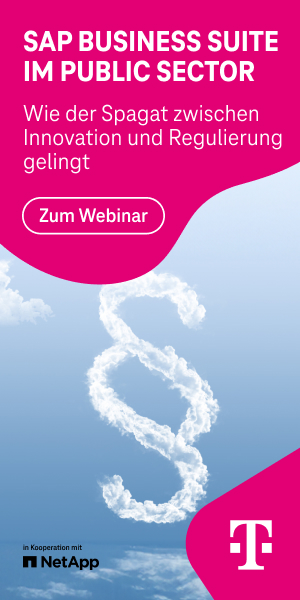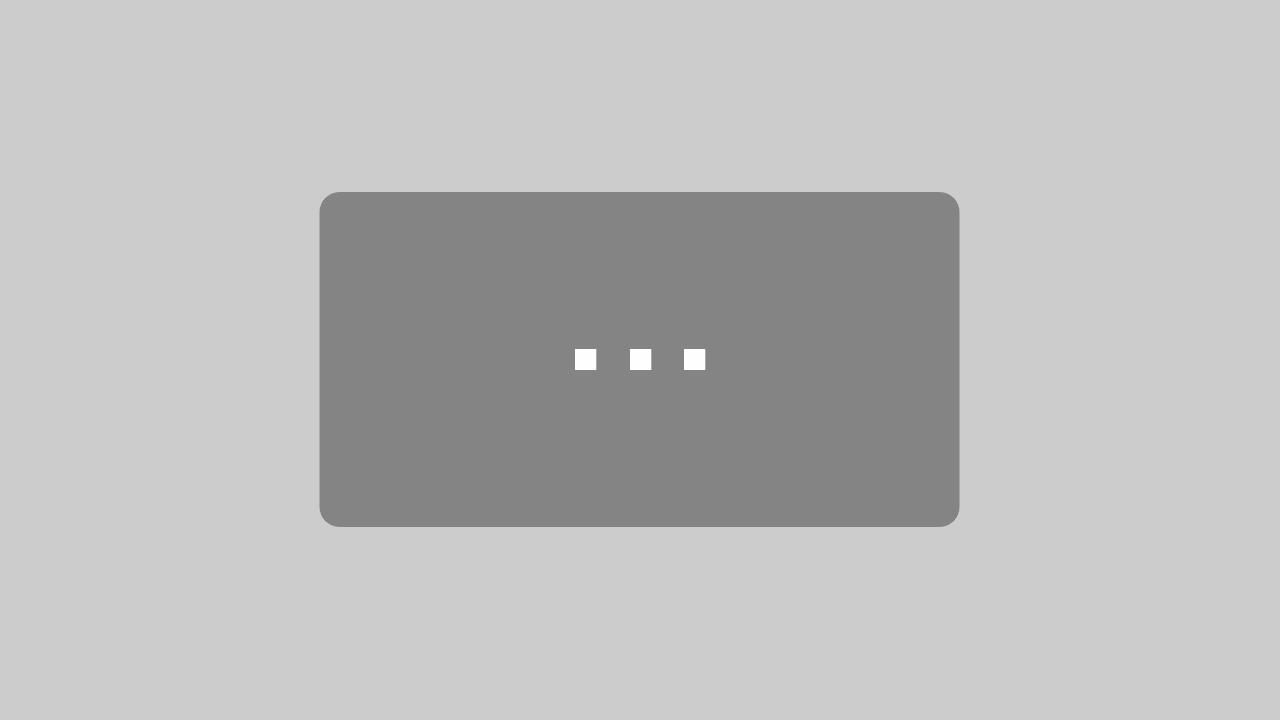Seit dem jüngsten Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist klar: Jede Behörde muss die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten vollständig, fälschungssicher sowie zeitnah dokumentieren. Was zunächst nach zusätzlicher Bürokratie klingt, eröffnet in Wahrheit die Chance, veraltete Routinen zu überwinden und Verwaltungsarbeit in eine neue Verlässlichkeit zu führen. Jetzt entscheidet sich, wie digitaler Alltag in der öffentlichen Verwaltung tatsächlich gelebt wird.
Noch nie stand die Frage nach verlässlicher Zeiterfassung im öffentlichen Dienst so deutlich im Fokus wie heute. Ob im Bauamt, in der Schule oder in der Polizeidienststelle, überall muss künftig minutiös festgehalten werden, wann Beschäftigte ihre Arbeit beginnen, unterbrechen und beenden. Hintergrund ist nicht nur die Umsetzung europäischer Vorgaben, sondern auch das wachsende Bewusstsein für faire Arbeitsbedingungen, Nachvollziehbarkeit sowie Transparenz. Die digitale Arbeitszeiterfassung wird damit zum Prüfstein moderner Verwaltungsführung: Sie zeigt, ob Behörden den Wandel nicht nur rechtlich erfüllen, sondern auch organisatorisch meistern können.
Was die Pflicht konkret bedeutet
Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist eindeutig geregelt, dass jede Behörde Beginn, Ende sowie Dauer der täglichen Arbeitszeit dokumentieren muss. Diese Aufzeichnungen sollen zeitnah, fälschungssicher und auch mobil möglich sein, so verlangt es das Bundesarbeitsministerium.
Gerade im öffentlichen Dienst mit Schichtdiensten, Gleitzeitkorridoren oder Bereitschaften ist das kein Selbstläufer. Systeme müssen flexibel genug sein, um verschiedene Arbeitsmodelle abzubilden, und zugleich höchsten Datenschutzanforderungen genügen. Digitale Lösungen wie die Factorial App zeigen, wie sich gesetzliche Vorgaben als auch praktische Nutzbarkeit verbinden lassen: mobil erfassbar, sicher und einfach zu bedienen.
Wichtig bleibt, dass Arbeitszeiterfassung nicht zur Leistungsüberwachung verkommt. Personalräte, Datenschutzbeauftragte sowie Dienststellenleitungen tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass Kontrolle in Transparenz übergeht und Modernisierung nicht das Vertrauen der Beschäftigten untergräbt.
Status quo in Deutschland und EU
In Deutschland arbeiten Erwerbstätige 2024 im Schnitt 34,3 Stunden pro Woche, Vollzeitbeschäftigte etwa 40,2 Stunden. Für Dienststellen bedeutet das, Arbeitszeitmodelle als auch Personalkapazitäten präzise auf diese Realität abzustimmen.
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit durchschnittlich 34,8 Wochenstunden knapp unter dem EU-Mittelwert von 37,1 Stunden. Bei Vollzeitbeschäftigten nähern sich die Werte an: 40,2 Stunden hierzulande gegenüber 40,3 im EU-Durchschnitt. Auffällig bleibt die hohe Teilzeitquote von 29 %, der dritthöchste Wert in der Europäischen Union. Diese Vielfalt erzeugt einen spürbaren Bedarf an flexiblen, datenbasierten Auswertungssystemen, um gerechte und effiziente Arbeitszeitstrukturen zu sichern.
Im öffentlichen Dienst sind inzwischen rund 5,4 Mio. Menschen beschäftigt, besonders viele in Bildungseinrichtungen sowie Kitas. Diese Zunahme bringt unterschiedlichste Schicht- und Einsatzlogiken mit sich. Ein weiterer Grund, auf standardisierte, revisionssichere Systeme zu setzen, welche Planung sowie Dokumentation nahtlos verbinden.
Von der Anforderungsliste bis zum Proof-of-Concept
Bevor eine Zeiterfassung in den Echtbetrieb geht, sollte klar definiert sein, was sie leisten muss. Barrierefreiheit, Hosting innerhalb von Deutschland oder der EU, transparente Service-Level-Agreements sowie geprüfte Audit-Exports gehören dabei ebenso auf die Pflichtliste wie eine Datenschutz-Folgenabschätzung, die von Beginn an berücksichtigt wird.
Für die Auswahl lohnt sich eine strukturierte Bewertungsmatrix, die nicht nur technische Parameter vergleicht. Entscheidend sind der praktische Nutzwert sowie die Gesamtkosten über den Lebenszyklus hinweg, also Lizenzen, Betrieb und Schulung.
Ein Proof-of-Concept über vier bis sechs Wochen schafft Klarheit. Eine Pilotdienststelle testet unter realen Bedingungen, ob sich eine Erfassungsquote von über 98 % erreichen lässt, die Korrekturrate unter 3 % bleibt und Genehmigungen zügig durchlaufen.
Orientierung gibt dabei der IT-Planungsrat mit seiner Digitalstrategie 2024/40, die Standardisierung und Skalierung föderaler Lösungen fördern soll. Wer diesen Rahmen ernst nimmt, legt den Grundstein für eine Verwaltung, die Innovation nicht ausprobiert, sondern verankert.
Ausblick für Bürger und Organisation
Die digitale Arbeitszeiterfassung ist mehr als eine juristische Pflicht. Sie verändert, wie Verwaltung Zeit, Verantwortung und Vertrauen organisiert. Wenn Daten sicher fließen und Systeme ineinandergreifen, entsteht eine neue Form von Transparenz im öffentlichen Dienst.
Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das verlässlichere Abläufe und nachvollziehbare Entscheidungen. Behörden, die jetzt investieren, zeigen, dass Digitalisierung kein Zusatzprojekt ist, sondern Teil einer modernen Verwaltungskultur.
Wer diese Entwicklung aktiv mitgestaltet, nutzt Technik nicht nur zur Kontrolle von Zeit, sondern zur besseren Nutzung von Zeit. Für Menschen, Organisationen und einen Staat, der effizient und nah zugleich agiert.
Dieser Beitrag ist eine Anzeige von Factorial. Die Autorin ist Sadie Smith.