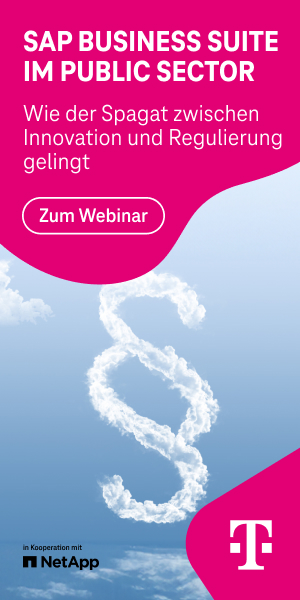Anfang Dezember bekommt der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion (DBB) einen neuen Fachvorstand Beamtenpolitik. Nach monatelanger Vakanz wird die hauptamtliche Spitze der Gewerkschaft damit wieder komplett. Zur Wahl stehen drei bekannte DBB-Gesichter – je eines aus den drei Gewerkschaftsbereichen Bundesbeamte, Landesbeamte und Fachgewerkschaften.
Milanie Kreutz ist bereits Stellvertretende DBB-Bundesvorsitzende – d. h. schon jetzt ehrenamtliches Mitglied der Bundesleitung – und Vorsitzende der DBB-Frauenvertretung. Die Finanzbeamtin gehört der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) an und ist somit Vertreterin der Fachgewerkschaften – dem Gewerkschaftsbereich, dem im DBB die meisten Mitglieder angehören. Als SPDlerin ist sie schon jetzt eine parteipolitische Ergänzung für den ansonsten CDU-geprägten Bundesvorstand.
Thomas Liebel ist der Jüngste unter den drei Bewerbenden. Er ist derzeit Bundesvorsitzender der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) und würde die Gruppe der Bundesbeamten innerhalb der Bundesleitung verstärken.
Heini Schmitt ist Landesvorsitzender der DBB in Hessen. Der Polizeioberrat a. D. gilt in seiner aktuellen Rolle als Vertreter der Landesbeamten. Seine Herkunftsgewerkschaft ist jedoch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Hessen, wo er zum Landesehrenvorsitzenden ernannt wurde.
Dienst mit Bedeutung
Alle drei Bewerbenden eint ihr klares Bekenntnis zum Berufsbeamtentum. Für Schmitt ist es ein wichtiger Stabilitätsanker, der dem Erhalt der Demokratie dient. Liebel sieht es als Fundament für einen verlässlichen, handlungsfähigen Staat. Kreutz beschreibt das Beamtentum als Schutz für Staat und Grundgesetz.
Vor der Abschaffung oder Beschränkung des Beamtentums warnen die Kandidatin und die Kandidaten eindringlich. Stattdessen müssten der Dienst und das besondere Treueverhältnis von Beamtinnen und Beamten geschützt werden. Kreutz geht sogar einen Schritt weiter und kann sich vorstellen, mehr Beschäftigten die Verbeamtung anzubieten – z. B. dann, wenn Tarifbeschäftigte durch eine Veränderung des Aufgabenbereichs mit hoheitlichen Aufgaben konfrontiert werden oder auch bei Lehrkräften, denn in schweren Zeiten müsse politische Bildung in staatlicher Hand bleiben.
Für ihre Treue und ihren besonderen Dienst verdienen die Beschäftigten im Gegenzug echte Wertschätzung und eine faire Alimentation – da sind sich Kreutz, Liebel und Schmitt einig. Doch für die kommenden Jahre stehen noch weitere Themen auf der Agenda, um einen starken Öffentlichen Dienst, ein zukunftsfähiges Beamtenrecht und gelingende Staatsmodernisierung sicherzustellen. Die drei Bewerbenden machen hierbei unterschiedliche Schwerpunkte aus.
Investitionen in die Zukunft
So wünscht sich Kreutz beispielsweise eine Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität. Der Öffentliche Dienst müsse attraktiv für Nachwuchskräfte sein und parallel das Bestandspersonal im Blick behalten. Dazu müsse mehr Rücksicht auf die Erwartungen aller Beschäftigten an flexible Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten genommen werden. Zudem müsse das Beamtenrecht durchlässiger gestaltet werden. Es brauche mehr dezentrale und hybride Möglichkeiten der Fortbildung und des Aufstiegs – insbesondere für Menschen, die Beruf und Familie miteinander in Einklang bringen müssten – und einen dynamischen Umgang mit Zu- und Abgängen von Beschäftigten, um auf individuelle Karrierewege reagieren zu können. Kreutz ist zudem die Vorsitzende der DBB Grundsatzkommission Mitbestimmung und betont die bedeutende Rolle der Personalvertretung im Prozess der Staatsmodernisierung.
Für Liebel ist besonders die Einbeziehung der Mitarbeitenden ein wichtiger Grundpfeiler für die die Verwaltung von morgen: „Staatsmodernisierung gelingt nur mit den Beschäftigten, nicht gegen sie. Wir brauchen mehr Beteiligung, bessere Ausstattung und funktionierende IT – keine Reformen auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen.“ Außerdem fordert er moderne und flexible Arbeitsbedingungen und echte Entwicklungsperspektiven.
Ein Recht für alle
Schmitt hebt drei weitere Aspekte hervor: stärkerer Rückhalt durch die Politik, besseren Schutz vor Übergriffen und den Rückbau von Bürokratie – auch im Beamtenrecht. Er kritisiert, dass Beamte überall die gleichen Aufgaben erledigten, beamtenrechtliche Sachverhalte aber 17-fach geregelt würden. Bei der Besoldung sei ein Wettbewerb entstanden – nach dem Motto: „Welcher Rechtskreis kann die verfassungswidrige Unteralimentation seiner Beamten am geschicktesten verschleiern?“ Der Polizeioberrat a. D. spricht sich daher eindringlich gegen weitere Flexibilisierungen und für die sukzessive und mühevolle Rückkehr zu einem einheitlichen Beamtenrecht aus.
Liebel tritt ebenfalls für ein modernes, einheitliches Beamtenrecht mit verbindlichen Standards für Besoldung, Versorgung und Laufbahnen ein. Er betont aber, dass gewisse Spielräume notwendig seien, um auf regionale und organisatorische Besonderheiten einzugehen. Einheitlichkeit und Gestaltungsspielraum schlössen sich nicht gegenseitig aus, sondern seien die Basis für eine gerechte, zukunftsfähige Verwaltung.
Kreutz stellt sich ebenfalls hintereinheitliche Regelungen im Beamtenrecht – gegen den Wettbewerb und für faire Arbeitsbedingungen. Mit Blick auf die Zusammenarbeit der föderalen Ebenen fordert sie einen Abbau von Zuständigkeitsüberschneidungen, eine ehrliche Aufgabenkritik, um Arbeitsbereiche sinnvoll einer Ebene zuzuordnen, und die stärkere Einbeziehung von Ländern und Kommunen. Beispielsweise könne der Bund digitale Dienstleistungen anbieten und den Kommunen zur Verfügung stellen, damit diese sie nicht selbst erstellen und anbieten müssten. Der DBB müsse bei diesen Themen, aber auch darüber hinaus, von der Politik stärker als aktiver Gesprächspartner wahrgenommen werden. In seinen Reihen finde Politik die Expertinnen und Experten des Öffentlichen Dienstes.
Eine besondere Wahl
Wer die vakante Leitungsposition übernimmt und damit die Nachfolge des im Mai verstorbenen Waldemar Dombrowski antritt, darüber stimmen im Dezember die 140 Mitglieder des DBB-Hauptvorstands ab. Eines ist schon jetzt klar: Diese Wahl ist ein Novum. Nach über 100 Jahren Gewerkschaftsgeschichte kandidiert mit Kreutz erstmals eine Frau für eine Spitzenposition im DBB. Ein längst überfälliger Schritt. Bei einem Wahlsieg könnte sie somit DBB-Geschichte schreiben und Türöffnerin für andere Frauen werden. Sie möchte den bislang geläufigen Weg vom ehrenamtlichen zum hauptamtlichen Mitglied in der Bundesleitung gehen.

Milanie Kreutz betont: In Zeiten, in denen die AfD auf dem Vormarsch ist, sind deutliche politische Lösungen gefragt, nicht juristische. Zudem findet sie, Schulungen zum richtigen Umgang mit Extremismus müssten nicht nur Teil der Ausbildung sein, sondern in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden.

Thomas Liebel ist überzeugt: Wer dem Staat dient, muss für dessen Werte einstehen. Die Verwaltung brauche daher klare Maßstäbe bei Auswahl, Fortbildung und Disziplinarrecht. Wertevermittlung, Demokratietraining und konsequentes Handeln bei nachweislichem Fehlverhalten seien entscheidend.

Heini Schmitt stellt klar: Nach geltendem Dienstrecht können Beamte, die extremistische Ziele verfolgen, nach Einzelfallprüfung durch Gerichtsentscheidung aus dem Dienst entfernt werden. Aus- und Fortbildungen, Jahresgespräche und Belehrungen müssten zur Sensibilsierung genutzt werden.