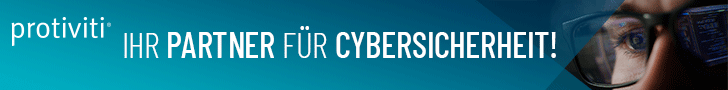Nicht selten liest man in der Tagespresse reißerische Schlagzeilen über ausufernde Feuerwehreinsätze und über Stunden wütende Feuer, wenn Elektrofahrzeuge in Brand geraten. Ein Blick in die Statistiken verdeutlicht jedoch, dass die Feuerwehren sehr gut in der Lage sind, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu löschen. Unterschiede im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen bestehen aber dennoch.
Dipl. Ing. Dr. Rolf Erbe, Dozent an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA), vergleicht die gegenwärtige Verunsicherung bezüglich der Brandgefahr durch Elektrofahrzeuge mit der Situation der Einführung von Air Bags. Auch damals wurden Schreckensnachrichten verbreitet. Nach der Einführungsphase erwies sich die Technik aber als sehr sicher. Der Experte prognostiziert daher: “In zehn Jahren werden wir zurückblicken und uns über die Ängste damals wundern.“ Allerdings müssten die Feuerwehren lernen, wie mit Fahrzeugtypen der Elektro- und Hybridklasse umzugehen sei. Die Zusammenarbeit mit der Industrie sei dafür unerlässlich. Gleichsam sei auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung über die potenzielle Gefahrenquelle „Akku“ von Nöten.
Einsatzabläufe sind vergleichbar
Der bisherige Modus Operandi sieht vor, dass die Feuerwehren beim Eintreffen an der Brandstelle zunächst einen Löscheinsatz, wie bei jedem brennenden Kraftfahrzeug durchführen. Ist die akute Brandsache gelöscht, muss in einem Folgeschritt überprüft werden, ob es sich beim brennenden Fahrzeug um ein Elektro- oder Hybridfahrzeug handelt. Ist dies der Fall, ist die Temperatur der Batterie zu messen, um Rückschluss über die Gefahr einer möglichen Entzündung zu erhalten. In den seltensten Fällen gerät die Batterie in Brand. Weitaus häufiger ist das sogenannte Ausgasen, also das Austreten dichten weißen Nebels. Trotz des anregenden Duftes der Dämpfe, warnt der Experte eindringlich davor diese einzuatmen.
Sobald die Reaktion durch Kühlung gestoppt und die Batterietemperatur auf ein akzeptables Maß gesunken ist, kann das Fahrzeug abtransportiert werden. Bei diesem Prozess bestehen jedoch noch Unklarheiten. Aufgrund der Gefahr einer erneuten Entzündung müssen die Fahrzeuge überwacht oder unter Quarantäne gestellt werden. Eine zeitraubende Aufgabe, die aus Sicht Erbes nicht den Feuerwehren überlassen werden sollte. Er begrüßt erste Ansätze der Bergungsindustrie, die havarierten Fahrzeuge in Containern abzutransportieren. Die Gefahr durch eine erneute Entzündung sowie das Austreten des mit gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien versetzten Löschwassers ist auf diesem Weg gebannt.
Fazit über bisherige Einsätze
Auffällig ist, dass mehr Löschwasser und Zeit zur Bekämpfung der Brände an Elektrofahrzeugen aufgewendet werden muss. Wenn die Reaktion in der Batterie beginnt, bleibt den Feuerwehren meist nur noch von außen zu kühlen. Auf diese Weise kann die Reaktion nur eingeschränkt, nicht aber unterbrochen werden. Erbe fordert die Automobilhersteller deshalb auf, Zugriffswege für die Feuerwehren zu schaffen, damit die Batterie selbst gelöscht werden kann. Auch eine einheitliche und einfache Möglichkeit den Stromkreis zu unterbrechen, wünscht sich der Experte von den Automobilherstellern.