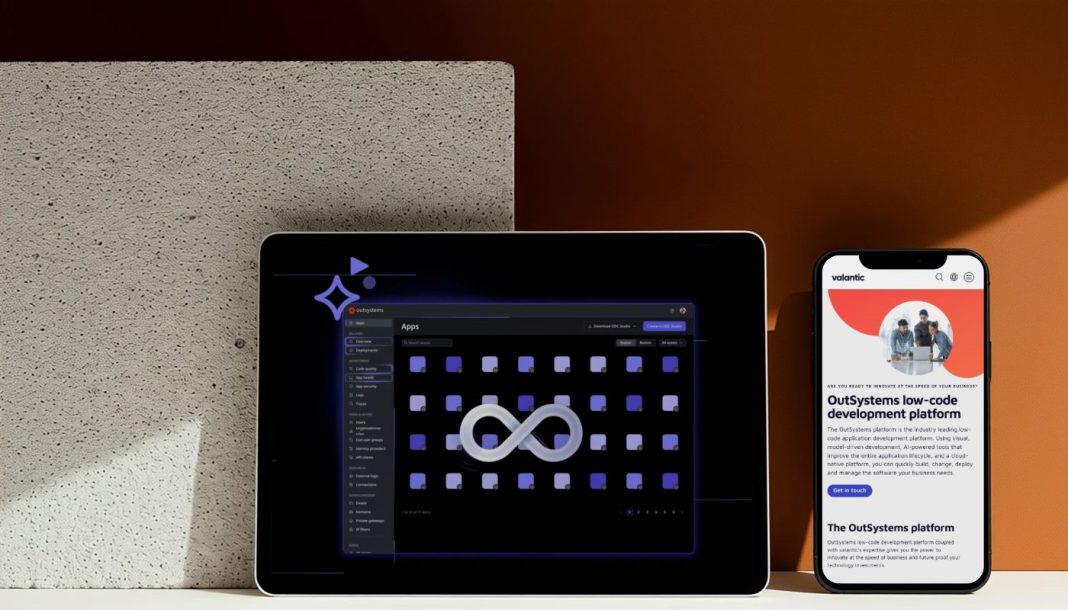Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet Schritt für Schritt voran, nicht nur in Bürgerportalen, sondern auch tief in den internen Abläufen. Überall im Land entstehen Initiativen: Die Kommission zur Sozialstaatsreform denkt Verwaltungsprozesse neu, der Digitalcheck prüft Gesetze auf ihre digitale Tauglichkeit, das ITZBund hat mit KIPITZ ein KI-Portal veröffentlicht, die Bundesagentur für Arbeit zeigt mit Mut den Weg zum digitalen Wandel und Städte wie München, Hamburg, Esslingen oder Konstanz zeigen, dass Digitalisierung in großen wie in kleineren Strukturen gelingen kann. Diese Entwicklungen beweisen, dass der Wandel längst begonnen hat – und dass die Verwaltung über enormes Wissen und Gestaltungskraft verfügt. Deutschland soll nicht ewig im unteren Mittelfeld des Digital Economy and Society Index (DESI) bleiben: Die digitalen Tüftler sind im Amt!
Diese Entwicklung macht Mut. Denn die Herausforderungen, die noch zu meistern sind, sind groß. Digitalisierung bedeutet heute mehr als nur Online-Anträge. Viele Verwaltungen müssen ihre internen Prozesse modernisieren: von digitalen Arbeitszuweisungen über automatisierte Dokumentenflüsse bis hin zu vereinfachten Genehmigungswegen. Registerbasierte Datenflüsse ermöglichen schnellere Entscheidungen, reduzieren Fehler und entlasten Mitarbeitende. Sie schaffen Raum für die eigentliche Verwaltungsarbeit, zum Entscheiden, Unterstützen und Gestalten. Noch ist das Once- Only-Prinzip, also die einmalige Erfassung und mehrfache Nutzung von Daten, nicht flächendeckend Realität. Doch die Grundlagen sind geschaffen: Register sind vorhanden, Schnittstellen entstehen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wächst. Wer die vorhandenen Datenbestände besser vernetzt, stärkt die Effizienz, spart Kosten und schafft Vertrauen in eine moderne, handlungsfähige Verwaltung.
Gibt es einen kurzen Weg zum digitalen Verfahren?
Ja, aber Realität ist: Klassische IT-Entwicklung kommt zunehmend an ihre Grenzen, Projekte dauern zu lange, Änderungen sind teuer, der Fachkräftemangel setzt genau dort an, wo es wehtut: Weniger Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst müssen mehr leisten – bei gleichzeitig steigenden Qualitätsanforderungen. Ganz zu schweigen von der Attraktivität der IT-Stellen im Öffentlichen Dienst. Hier ist es schwer, mit Start-ups und digitalen „Grown-ups“ konkurrenzfähig zu sein.
In diesem Umfeld kann Low-Code für viele Behörden einen starken Automatisierungsschub auslösen. Auf allen Ebenen der föderalen „Schichttorte“, von kleinen Kommunen über Fachbehörden bis hin zu Ländern und Bundesorganisationen, unterstützt Low-Code auf dem Weg zur Registermodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Low-Code-Plattformen ermöglichen es Behörden, Fachverfahren visuell zu modellieren, Registerdaten anzubinden und Prozesse zu automatisieren, ohne dafür programmieren zu müssen. So wird die Verwaltung selbst zum Gestalter ihrer digitalen Zukunft.
Rahmenverträge als Beschleuniger
Dank der interföderalen Ausschreibung von Low-Code-Plattformen durch die PD – Berater der öffentlichen Hand – ist seit März 2024 die Nutzung von vier Automatisierungsplattformen (Appian, Pega und ServiceNow als vorgangsorientierte Plattformen, OutSystems als einzige entwicklungsorientierte Plattform) über Rahmenverträge für eine Vielzahl öffentlicher Träger möglich. Diese Ausschreibung wurde durch Dienstleistungsrahmenverträge ergänzt. Durch diese Vereinbarungen soll die Digitalisierung in öffentlichen Einrichtungen wie Kommunen, Fachbehörden, Bundesämtern und Ländern vorangetrieben werden.
Low-Code-Plattformen bieten hier einen neuen Weg. Ein wesentlicher Vorteil von Low-Code besteht darin, dass Änderungen, etwa durch neue Gesetze oder Richtlinien, sich innerhalb weniger Tage umsetzen lassen. Die Fachlichkeit bleibt in den Händen der Verwaltung, während technische Governance, Sicherheit und Compliance zentral von den Betreibenden der Plattform gewährleistet werden.
Im Mittelpunkt steht ein kultureller Wandel. Digitalisierung wird nicht länger als einmaliges Projekt verstanden, sondern als fortlaufender Verbesserungsprozess. Fachbereiche und IT arbeiten enger zusammen. Prozesse werden modelliert statt programmiert, Nutzerinnen und Nutzer werden früh eingebunden. Die Verwaltung wird agiler, ohne ihre Stabilität zu verlieren.
Governance-Strukturen und konstante Überprüfung der Entwicklungsqualität, die beide Bestandteil der Low-Code-Plattformen sind, stellen sicher, dass Innovation nicht in Wildwuchs und Sicherheitslücken endet, sondern in geordneten Bahnen bleibt. Jede Behörde, die diesen Weg beschreitet, wird Teil einer größeren Bewegung: hin zu einer offenen, lernfähigen und vernetzten Verwaltung. Die Technik ist das Werkzeug; der eigentliche Wandel findet in der Haltung statt.
Das Once-Only-Prinzip wird Realität – registerbasiert denken
Das Once-Only-Prinzip wird Realität, wenn Daten, die bereits in einem Register vorhanden sind, nicht erneut abgefragt werden müssen. Registerbasierte Prozesse ermöglichen es, Informationen automatisch zu übernehmen, Bescheide vorzubereiten oder Prüfungen digital auszulösen. So entstehen Fachverfahren, die medienbruchfrei funktionieren – von der Antragstellung bis zur Entscheidung. An dieser Stelle ist eine Unterscheidung wichtig – zwischen vorgangsorientierten Systemen, die aus dem Prozess gedacht sind, und registerorientierten Systemen wie OutSystems, bei denen Arbeitsabläufe, Eingabemasken und Arbeitsstrukturen aus den Registerdaten heraus entwickelt werden. Moderne registerorientierte Low-Code-Entwicklungsplattformen wie OutSystems schaffen die Grundlage für die Vernetzung der Register und für den Aufbau digitaler Prozesse auf Basis dieser wertvollen Datenstände.
Auf der Bürger- bzw. OZG-Seite entstehen beispielsweise Antragsstrecken, Formulare, Genehmigungsprozesse, die Erstellung von Bescheiden, Registerzugriffe und mobile Applikationen. Diese ähneln entweder den Anwendungen, die Bürgerinnen, Bürger und Behördenmitarbeitende aus ihrem Privatleben kennen, oder sie werden so gestaltet, dass sie den Anforderungen einer nicht digitalaffinen oder nicht deutschsprachigen Nutzerschaft entsprechen. Letztere Fähigkeit ist insbesondere durch die Nutzung der entwicklungsorientierten Plattform OutSystems gegeben. Gleichzeitig können auf derselben Plattform auf der Dezernatsseite vielfältige Lösungen zur Beschleunigung interner Prozesse, etwa im Fördermittelmanagement, in der Ressourcenplanung oder bei Arbeitszuweisungen, entwickelt werden.
EfA-Prinzip und Basiskomponenten
Darüber hinaus können wir mit der Plattform OutSystems standardisierte, wiederverwendbare Bausteine bereitstellen, die als digitale Form des EfA („Einer für Alle“)-Prinzips Kosten senken, Standardisierung fördern und die Verfahrensdigitalisierung beschleunigen. Diese sogenannten Basiskomponenten sind vielfältiger Natur: standardisierte Eingabemasken (z. B. für eine natürliche oder eine juristische Person in ergonomischer und barrierefreier Form), Vorgangstypen oder standardisierte Schnittstellen und Absicherungsmechanismen (z. B. Bund-ID, XÖV, Fit-Connect, KIPITZ, Bezahldienste) und vieles mehr.
So bietet Low-Code im Vergleich zu Standardsoftware und Eigenentwicklungen mehr Resilienz. Wenn sich Gesetze ändern, können Anpassungen ohne monatelange Entwicklungszyklen erfolgen. Die Fachlichkeit bleibt aktuell, Systeme bleiben stabil, Bürgerinnen und Bürger profitieren unmittelbar.
Dieselbe Struktur der Basiskomponenten hilft beispielsweise der Plattform OutSystems dabei, Geschäftslogiken, User-Interface- Komponenten und Datenmodelle veränderbar und wiederverwendbar zu machen. Das vereinfacht die Wartbarkeit und die Modularität auch großer Applikationen. So entsteht eine digitale Infrastruktur, die die Verwaltung von morgen trägt.
Low-Code als fertiges Werkzeug zur Digitalisierung wäre ohne Datensouveränität wenig wert. High-Performance-Low-Code-Plattformen unterstützen souveräne Betriebsmodelle – ob in der Cloud (souveräne Cloud, SecNumCloud oder Deutsche Verwaltungscloud), im Rechenzentrum der öffentlichen Hand oder in hybriden Szenarien. Daten bleiben dort, wo sie entstehen, während Anwendungen flexibel skaliert werden können.
Digitale Souveränität als Voraussetzung
Technisch entsteht ein Ökosystem aus klaren Schnittstellen, getrennten Daten- und Prozessschichten sowie konsequenter Verschlüsselung. Die Verwaltung behält die Kontrolle, auch wenn sie sich technologisch öffnet. Diese Datensouveränität wird verstärkt durch die Möglichkeit des Einsatzes souveräner KI-Agenten und -Produkte, etwa On-Prem-LLM (Large Language Models), SLM (Small Language Models) und europabasierter KI (z.B. Mistral).
Was vor wenigen Jahren noch als Experiment galt, ist heute eine strategische Notwendigkeit. Registerbasierte Low-Code-Plattformen sind keine Mode, sondern das Fundament einer modernen Verwaltung. Sie verbinden Fachlogik, Rechtssicherheit, Datensouveränität und Bürgernähe – und machen die öffentliche Hand in
einer Zeit des permanenten Wandels handlungsfähig.
Die digitale Verwaltung ist damit kein ferner Traum mehr, sondern eine reale Option – sofern sie den Mut hat, sich selbst neu zu denken. Wer heute investiert, baut nicht nur Software, sondern gestaltet das Rückgrat des Staates von morgen: agil, interoperabel, sicher und menschlich zugleich. Das ist die Geschichte, die jetzt geschrieben wird.
Das Unternehmen valantic mit Sitz in München begleitet Behörden in Deutschland und Europa auf ihrem Weg zu einer modernen, effizienten und souveränen digitalen Verwaltung und freut sich, den Zuschlag für den bundesweiten Rahmenvertrag zur Low-Code-Umsetzung auf Basis von OutSystems erhalten zu haben.
Dieser Beitrag ist eine Anzeige von valantic. Die Autoren sind die valantic-Experten Frédéric Cuny (frederic.cuny@lcs.valantic.com), VP EMEA Low-Code and Hyperautomation, und Bernd Männel (bernd.maennel@nxt.valantic.com), Director Public Sector.