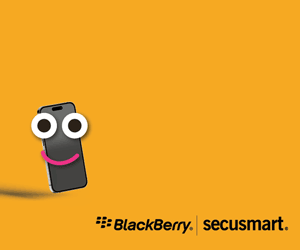Mit Blick auf die kommenden zehn Jahre wird es nie mehr so einfach sein, freie Stellen zu besetzen wie gegenwärtig. Der Fachkräftemangel ist da und wird ab jetzt nur noch zunehmen, und zwar deutlich. Dabei wird es Phasen geben, in denen es wieder leichter fällt, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst zu interessieren. Denn in Krisenzeiten und bei Konjunkturdellen steigt erfahrungsgemäß die relative Attraktivität der Jobs im öffentlichen Sektor. Aber: Wie Wetter nicht mit Klima verwechselt werden sollte, darf eine temporäre Entspannung beim „Recruiting“ nicht als Entwarnung hinsichtlich des Fachkräftemangels missverstanden werden.
Der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Sektors durch die Verfügbarkeit von Personal begrenzt wird. Die Öffentliche Verwaltung ist bislang daran gewöhnt, dass Haushaltsmittel der limitierende Faktor sind. Gilt es, etwas zu bewegen oder Probleme zu lösen, so ist dies möglich, indem zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Geld löste Probleme. Das englische Idiom hierzu: „To throw money at a problem“. Die Verwaltung lebt in der Gewissheit, dass sich jedes Problem lösen lässt, sofern sich nur ein hinreichend starker politisch-administrativer Wille formiert, ein großes Paket (neudeutsch: „Wumms“) zu schnüren. Denn dieser Wille ermöglicht es, den Flaschenhals der begrenzten Haushaltsmittel zu überwinden. Der Flaschenhals wiederum resultiert aus mehr oder weniger strengen, aber in jedem Fall selbst gesetzten Grenzen wie der Schuldenbremse oder dem kommunalen Haushaltsausgleichsgebot.
Der Fachkräftemangel untergräbt diese Gewissheit. Geld ist nicht mehr der primär limitierende Faktor. Selbst wenn Geld zur Verfügung steht, könnten die Dinge womöglich nicht wie gewünscht bewerkstelligt werden, weil es an den Fachkräften fehlt, die die Arbeit machen. Für die öffentliche Verwaltung ist dieses Stoßen an harte, selbst mit monetären Mitteln und Gesetzgebung nicht überwindbare Grenzen eine neue Erfahrung.
Vergütungswettlauf keine Lösung
Der denkbare Reflex, auch diese Situation versuchsweise mit Geld zu überwinden, wird nicht funktionieren. Ein Vergütungswettlauf mit der Wirtschaft deutet sich heute bereits an; er würde aber nur Verliererinnen und Verlierer zeitigen. Volkswirtschaftlich muss Humankapital in produktive, wohlstandsfördernde Sektoren gelenkt werden. Verzerrt die öffentliche Hand diese Allokation durch übermäßige steuerfinanzierte Vergütungserhöhungen, nimmt der Wohlstand insgesamt ab. Ein Vergütungswettlauf führte zudem zu Kostenstrukturen im öffentlichen Dienst, die die Bürger mittelfristig nicht bereit wären, durch Steuern zu finanzieren.
Der öffentliche Dienst muss sich (wieder einmal) reformieren. Der Fachkräftemangel zwingt ihn dazu. Reform ist nichts Neues, möchte man denken, denn Verwaltungsreform ist eine stetige Begleiterin des öffentlichen Dienstes. Und doch ist heute etwas anders: Wie oben ausgeführt, rührt der Veränderungsdruck erstmals in der jüngeren Geschichte aus einer harten Grenze. Hart meint hier: extern (demografisch) determiniert und insofern aus Sicht der Verwaltung kaum beeinflussbar. Sie zwingt die Verwaltung nicht in eine weitere Reformrunde nach den bekannten Spielregeln, sondern stellt sie vor einen grundlegenden Wendepunkt. Der Fachkräftemangel ändert die Spielregeln.
„Geschäftsmodell“ der öffentlichen Verwaltung anpassen
Der Begriff der „Verwaltungsreform“, wie er bisher konnotiert ist, passt insofern nicht zu der beschriebenen Herausforderung. Verwaltungsreformthemen der vergangenen Jahrzehnte waren Budgetierung, dezentrale Ressourcenverantwortung, Kosten- und Leistungsrechnung, partizipative Führung, Doppik-Einführung, New Work – und parallel dazu immer das Thema der Digitalisierung. All diese Reformen waren wichtig und in ihrer Zeit kleine Revolutionen. Sie haben den öffentlichen Dienst verbessert und wir profitieren heute von ihnen. Das, was jetzt ansteht, ist jedoch – um es mit Worten aus der Privatwirtschaft zu formulieren – die Notwendigkeit einer Veränderung des zugrunde liegenden Geschäftsmodells.
Die Reform, die erforderlich ist, heißt Industrialisierung der Produktion von Verwaltungsdienstleistungen.
Verwaltung arbeitet heute vielfach noch wie eine Manufaktur: Sie bildet Handwerkerinnen und Handwerker aus, die mit einigen wenigen Werkzeugen fast alle Verwaltungsprodukte erstellen können. Die Werkzeuge heißen Verwaltungsakt, Vermerk und Verfügung. In ortsnahen Handwerksbetrieben werden die Dienstleistungsprodukte erstellt und die Kundschaft kann sogar individuelle Wünsche äußern, wie man es gerne hätte.
Handwerklich erstellte Dienstleistungen haben aber einen Nachteil: es werden dafür knapper werdende Fachkräfte gebraucht und die werden laufend teuer. Handwerksarbeit droht Luxus zu werden.
Industrialisierung in Dienstleistungsfabriken
Eine Branche, die ein Lied davon singen kann, ist die Gastronomie. In der handwerklichen Küche braucht es die Köchin oder den Koch. Drei Jahre Ausbildungszeit, mittelgut bezahlt, schwierige Arbeitszeiten. In der Folge hat die Branche ein riesiges Nachwuchsproblem und ein Kostenproblem noch dazu, denn die Zahlungsbereitschaft für das dargebotene Produkt hat Grenzen.
Die Antwort der Gastronomie: Industrialisierung der Dienstleistungserstellung.
Was heißt Industrialisierung bei Dienstleistungen? Zum Beispiel die Trennung vom Front Office beim Kunden, also dem personenbezogenen Dienstleistungsprozess, von der Back Office-Arbeit. Die Zusammenfassung der Back Office-Arbeit erlaubt die Errichtung von zentralisierten Dienstleistungsfabriken mit hohen Stückzahlen, die stärker arbeitsteilig und automatisiert das Produkt erstellen oder zumindest weitgehend vorproduzieren. Um diesen industriellen Vorproduktionsprozess zu ermöglichen, muss das Produkt wiederum entsprechend gestaltet sein: modularisiert und standardisiert, also aus in unterschiedlichen Produkten nutzbaren Einzelkomponenten mit insgesamt reduzierter Komplexität, um die Vorteile einer Automatisierung voll ausnutzen zu können. Und natürlich wo immer möglich digitalisiert, um ortsungebunden produzieren und ggf. sogar ausliefern zu können.
Vom kleinen Topf in die Großküche
In der Gastronomie hat die Industrialisierung dazu geführt, dass heute geschätzt 80 % der Gerichte, die als Mittagstisch in den Restaurants und Kantinen am Rande großer Bürostandorte angeboten werden, Convenience Food sind. Diese wird in industriellen Großküchen gekocht und dann als Fertiggericht angeliefert. Eine Folge: Es gibt kaum noch ein Mittagstischgericht mit Salzkartoffeln. Salzkartoffeln bekommen außen eine Haut, wenn man sie aufwärmt, und innen werden sie eher weicher. Beides, zumal in Kombination miteinander, ist kulinarisch eher suboptimal. Der industrialisierte Prozess kommt mit Pommes, Kartoffelecken oder Bratkartoffeln besser klar. Vor Ort braucht es dann einerseits die Servicekraft, andererseits aber eben nur noch angelernte Küchenhilfen zum Aufwärmen oder Frittieren.
Die Verwaltung arbeitet häufig noch in handwerklichen Manufakturen. Sie kocht Salzkartoffeln in kleinen Töpfen.
Die Verwaltung wird industrielle Prozesse einführen müssen. Sie wird ihre Produkte standardisieren und modularisieren müssen, damit sie in Shared Service-Fabriken effizient produziert werden können und vor Ort allenfalls noch auszuliefern sind. Der Fachkräftemangel in Kombination mit dem Kostendruck zwingen zu dieser Reformentwicklung.
Industrialisierung als Zielbestimmung führt weg von den schönen, „kuscheligen“ Verwaltungsreformthemen wie dezentraler Verantwortung. Oder auch von generischen Zielen, gegen die niemand etwas haben kann: Verwaltungsvereinfachung, Deregulierung oder Digitalisierung.
Lieber Pommes, als gar nichts zu essen
Industrialisierung hat eine eher hässliche Konnotation. Aber Industrialisierung von Verwaltungsdienstleistungen als Zielbestimmung verspricht, den Fokus auf die Lösung der tatsächlich drängenden Probleme zu richten. Industrialisierung als Ziel erkennt an, dass in vielen Bereichen der Verwaltung die oben genannte Veränderung des Geschäftsmodells ansteht. Industrialisierung erkennt an, dass vor allem die Prozesse mit hohen Stückzahlen in den Blick zu nehmen sind und, dass wirtschaftlich spürbare Skaleneffekte angestrebt werden müssen. Sie erkennt an, dass die Veränderung von Normen und Leistungen und der vielfach kleinteiligen örtlichen Strukturen Voraussetzungen für Lösungen sind, die von der Größe her zu den Problemen passen, die auf den öffentlichen Dienst absehbar zukommen.
Vieles, was mit Industrialisierung einhergeht, muss man nicht mögen. Arbeitsplätze werden durch arbeitsteilige Prozesse zwar deutlich produktiver, aber tendenziell auch weniger qualifiziert. Aber wenn wir vor der Alternative stehen: Keine Fachkräfte für den handwerklichen Prozess und keine Bereitschaft, dessen Kosten auf Dauer zu akzeptieren, dann geht womöglich kein Weg an dieser Reform vorbei. Lieber Pommes, als gar nichts zu essen in der Büro-Mittagspause. Denn: was nicht industriell herstellbar ist, kann es vielleicht irgendwann gar nicht mehr (zu bezahlbaren Preisen) geben. Warum gibt es bei Tesla, Volvo oder anderen Autoherstellern keine Ledersitze zu kaufen? Weil Leder als Naturmaterial nur schwer in industriellen Prozessen verarbeitet werden kann. Haben die Kundinnen und Kunden das akzeptiert? Ja, das haben sie; der Markt hat „veganes Leder“ als neues Produkt auch in der automobilen Oberklasse hingenommen. Fein ziselierte Regelungen zur Einzelfallgerechtigkeit werden in der Verwaltung ersetzt werden müssen durch pauschalere und einfachere Vorgaben, weil nur diese eine industrielle Bearbeitung ermöglichen.
Was die Idee der Bierdeckel-Steuererklärung nicht vermochte, erzwingt der Nachwuchsmangel
Industrialisierung von Verwaltungsdienstleistungen könnte in den kommenden Jahren ein Orientierung gebendes Reformziel sein. Zum Glück ist es nicht wirklich neu. Die Finanzverwaltung ist sicherlich kein Vorreiter der Verwaltungsvereinfachung, gleichwohl hat sie in Bezug auf die Automatisierung der Bearbeitung durchaus Großes bewegt. Bei ihr waren und sind die möglichen Gewinne durch Automatisierung und Skaleneffekte augenfällig. Wie viel mehr wäre möglich, wenn nun auch noch das Steuerrecht verändert werden könnte! Was das politische Werben für die Schönheit der Steuererklärung auf einem Bierdeckel oder das Plädoyer für Bürgerfreundlichkeit an Vereinfachung im Steuerrecht nicht bewirken konnten, wird der Nachwuchsmangel in der Laufbahn des gehobenen Steuerverwaltungsdienstes womöglich erzwingen. Auch die tiefgreifenden Veränderungen in der Landschaft der Krankenkassen oder der Arbeitsverwaltung könnten als Beispiel dienen.
Soweit eine Industrialisierung kleinteilige örtliche Strukturen auflösen oder hierarchische Strukturen verschlanken muss, gibt es gleichwohl für die Betroffenen keinen Grund, sich um die persönlichen Karrierechancen zu sorgen: Wenn die Generation „Baby Boomer“ in der Verwaltung in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand geht, wird die Generationen „Pillenknick fortfolgende“ mit Beförderungsmöglichkeiten überhäuft. Denn erfahrungsgemäß gibt es für Beförderungsstellen stets ausreichend Nachfrage.
Insbesondere Kommunal- und Landesverwaltungen werden die Industrialisierung der Erstellung ihrer Dienstleistungen angehen müssen, auch dort, wo es heute noch weniger Bereitschaft dafür gibt. Denn die knapper werdenden Fachkräfte werden wir in Zukunft brauchen für die wichtigen Aufgaben, die sich gerade nicht industrialisieren lassen. In Bereichen wie Bildung, Sicherheit, Integration, Gesundheit oder Kultur gibt es diese zuhauf.
Industrialisierte Verwaltung – die Gesetzgebung ist gefordert
Die Verwaltung arbeitet gebunden an Recht und Gesetz. Darauf müssen Bürgerinnen und Bürger vertrauen können. Der Fachkräftemangel kann in einem schleichenden Prozess zu einer Überforderung der Verwaltung führen, die dieses Vertrauen untergräbt. Gerade in der langsamen Erosion liegt die politische Gefahr: Der Handlungsdruck, die Überforderung der Verwaltung zu verhindern, wird gefühlt vermutlich stets geringer sein als der Druck der nächsten akuten Krise. Verwaltungsreform braucht daher ein starkes Narrativ: Die Veränderung des Geschäftsmodells für die Verwaltung ist Voraussetzung für ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit, diese ist wiederum Voraussetzung für das Vertrauen in einen funktionierenden Staat mit einer funktionierenden Verwaltung.
Allerdings steht die in vielen Gesetzen noch verankerte herkömmliche Konzeption der Verwaltung (kleinteilige Einzelfallgerechtigkeit ohne Wesentlichkeitsschranken oder Regelungen ohne Rücksicht auf ihre Vollziehbarkeit) einer grundlegenden Veränderung ihres Geschäftsmodells im Weg. Die Verwaltung kann den Umstieg nicht allein bewerkstelligen, denn eine Anpassung vorhandener Gesetze ist eine Voraussetzung für den Veränderungsprozess. Dies ist die vielleicht größte Herausforderung. Die für die Vorbereitung von Gesetzesreformen verantwortlichen Ministerialverwaltungen des Bundes und der Länder müssen für die Umsteuerung in Richtung der Industrialisierung der Fertigung von Verwaltungsprodukten gewonnen werden. Nur sie können den Regierungen und Parlamenten Änderungsvorschläge für das vorhandene Regelwerk ausarbeiten.
Auf die politisch Verantwortlichen kommt dann nicht nur die Aufgabe zu, diesen Veränderungsprozess zu gestalten, sondern auch, ihn zu verkaufen. Denn nicht überall stoßen Pommes sofort auf Begeisterung …
Die Autoren des Gastbeitrags sind Matthias Kammer und Philipp Häfner.


Matthias Kammer war von 2019 bis 2021 Gründungsgeschäftsführer der govdigital eG, von 2011 bis 2018 Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI). Von 2004 bis Oktober 2011 war er Vorstandsvorsitzender des gemeinsamen IT-Dienstleisters Dataport für die Verwaltungen Hamburgs und Schleswig-Holsteins, zuvor über viele Jahre Mitarbeiter der Hamburger Verwaltung. Von 2008 bis 2016 war er Vorsitzender des Forschungsverbundes ISPRAT e.V. und nach dem Zusammenschluss bis 2018 Co-Vorsitzender des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums (NEGZ e.V.) mit Sitz in Berlin.
Philipp Häfner ist seit 2007 Direktor beim Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Aufsatz gibt seine persönliche Meinung wieder. Zuvor war er Partner einer Unternehmensberatungsgesellschaft und für Kommunen und Ministerien in ganz Deutschland tätig.