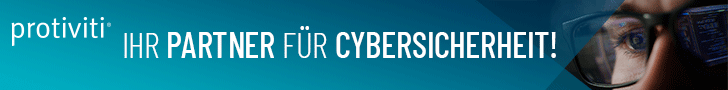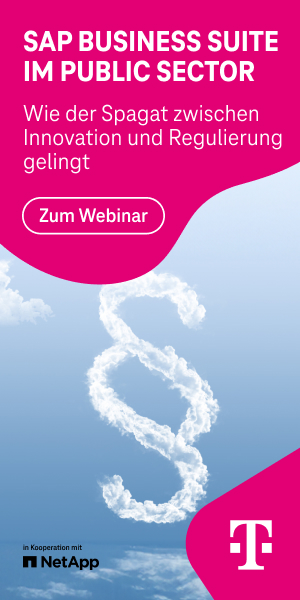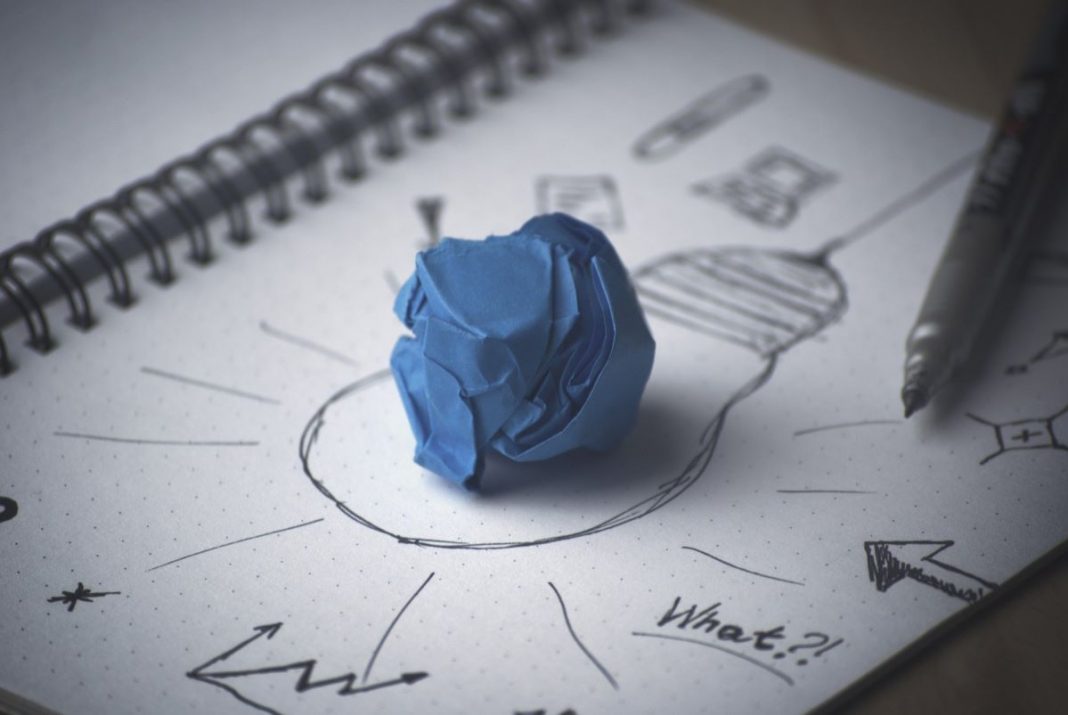Es brauche angesichts zunehmender Naturkatastrophen und wachsender sicherheitspolitischer Bedrohungen einen stärken Bevölkerungsschutz. Dies fordern die fünf anerkannten Hilfsorganisationen in Deutschland in einem gemeinsamen Positionspapier. In den Forderungen findet sich viel Bekanntes wieder. Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD) stellen in dem Papier sechs Kernforderungen auf:
1. Einheitliches Krisenmanagement aufbauen
Ein integriertes Krisenmanagement, das alle staatlichen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure einbezieht, muss entwickelt und konsequent umgesetzt werden. Standardisierte Verfahren, gemeinsame Ausbildungen und regelmäßige Übungen sind essenziell, um länderübergreifende Einsatzlagen effizient zu bewältigen.
2. Rechtliche Rahmenbedingungen modernisieren
Ein modernes Krisenmanagement erfordert klare gesetzliche Regelungen. Die Organisationen fordern unter anderem eine Reform des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes sowie eine bundeseinheitliche Regelung zur Freistellung, sozialen Absicherung und finanziellen Entschädigung ehrenamtlicher Helferinnern und Helfer – analog zu bestehenden Regelungen für das Technische Hilfswerk und Feuerwehren.
3. Finanzielle Ausstattung verbessern
Der Anteil des Bundeshaushalts für den Bevölkerungsschutz muss dauerhaft auf mindestens 0,5 Prozent (ca. 2,4 Milliarden Euro) angehoben werden. Nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung können die Organisationen ihre Ausrüstung modernisieren und Einsatzbereitschaft sicherstellen.
4. Ehrenamt stärken und fördern
Ohne Ehrenamt keine Katastrophenhilfe: Um Helferinnen und Helfer langfristig zu binden und neue zu gewinnen, sind attraktive Rahmenbedingungen notwendig. Dazu zählen die Förderung von Freiwilligendiensten und der Ehrenamtskoordination sowie eine stärkere staatliche Unterstützung etwa durch Maßnahmen im Sozialversicherungsrecht.
5. Gesellschaftliche Resilienz stärken
Die Menschen in Deutschland müssen aktiv in den Bevölkerungsschutz eingebunden werden. Durch Bildungs- und Informationsprogramme sollen Bürgerinnen und Bürger in Selbstschutzmaßnahmen geschult werden, um in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben.
6. Internationale Zusammenarbeit ausbauen
Krisen machen nicht an Landesgrenzen halt. Deutschland muss sich stärker in internationale Netzwerke einbringen und sich als verlässlicher Partner für die zivile Katastrophenhilfe positionieren.
Die Hilfsorganisationen schließen ihre Forderungen mit einem drastischen Appell an die kommende Bundesregierung. Diese müsse die vorgeschlagenen Maßnahmen zügig umsetzen und schnellstmöglich Reformen einleiten. Martin Schelleis, Bundesbeauftragter für Krisenresilienz bei den Maltesern, erklärte dazu: „Es gibt einige Aufgaben, die jetzt durch die neue Bundesregierung initiiert werden müssen. Dazu gehört die Weiterentwicklung der nationalen Sicherheitsstrategie. Das muss dann auch der Ausgangspunkt für konkretes Handeln sein, zum Beispiel für eine neue Wehrstruktur. Parallel zum militärischen muss auch der zivile Bedarf für das Funktionieren staatlicher Institutionen und kritischer Infrastruktur sowie für Schutz und Versorgung der Bevölkerung gedeckt werden.“