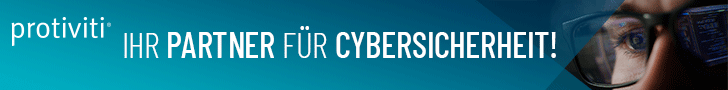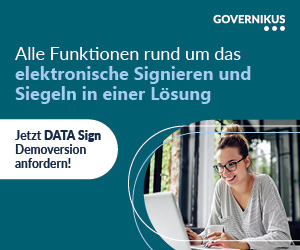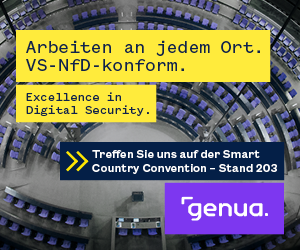Es gibt nicht viele ihrer Art: Landesämter, die rein für den Katastrophenschutz zuständig sind. Während in den meisten Bundesländern die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in den jeweiligen Innenministerien organisiert wird, geht die rheinland-pfälzische Landesregierung einen anderen Weg. René Schubert, der erste Präsident des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK), erklärt im Gespräch, was das Amt leisten soll. Das Interview führte Bennet Biskup-Klawon.
Behörden Spiegel: Wie viel Ahr-Katastrophe ist in Ihrem Amt?
René Schubert: Die Katastrophe war zweifellos der Punkt, an dem die Aktivitäten zur Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz erheblich intensiviert wurden. Es gibt jedoch Erkenntnisse, die aus der Pandemiephase stammen und bereits in den Prozess eingeflossen sind. Zudem gab es schon zuvor Vorarbeiten seitens der Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und der LFKA, bei denen festgestellt wurde, dass wir uns in bestimmten Bereichen als Land besser aufstellen müssen.
Die Katastrophe war der entscheidende Moment, der den Prozess sicherlich auch maßgeblich beschleunigt hat. Besonders wertvoll war hier die Enquete-Kommission. Sie hat zahlreiche Empfehlungen abgegeben, die nun in der Umsetzung – soweit es möglich ist – berücksichtigt werden.
Behörden Spiegel: Wie viel war für das Amt durch die verschiedenen Gutachten vorgezeichnet? Welche Vorstellungen konnten Sie selbst einbringen?
Schubert: Es gab natürlich bereits vorbereitende Arbeiten seitens der Kolleginnen und Kollegen, die über langjährige Expertise im Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz verfügen. Mit diesen Kenntnissen wurden damals die Gutachter und das Projektteam beauftragt. In dieses flossen insbesondere die Ergebnisse der Enquete-Kommission ein, die nach der Ahr-Katastrophe eingerichtet wurde. Gutachten und Projektergebnisse sind im Wesentlichen die Leitfäden für die Landesverwaltung geworden. Die weiteren Aktivitäten der Landesverwaltung – sei es in Bezug auf gesetzliche Neuausrichtungen oder die Errichtung des Landesamtes – orientieren sich stark an diesen.
Natürlich gibt es im Verlauf des Prozesses auch neue Erkenntnisse. An bestimmten Stellen wird festgestellt, dass sich der Wissensstand weiterentwickelt hat, was dazu führt, dass bestimmte Maßnahmen angepasst oder verändert werden. Zum Beispiel wurde die Struktur des Lagezentrums in den letzten Monaten des vergangenen Jahres nochmals neu bewertet. Insbesondere die Schichtmodelle und die Anwesenheit von Kolleginnen und Kollegen wurden überdacht und noch leistungsfähiger gestaltet.
Ich hatte die Gelegenheit als stellvertretender Projektleiter in der damaligen Projektstruktur zum Aufbau des Amtes tätig zu werden. Das war eine wertvolle Chance für mich, die Neuausrichtung kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Meine Erfahrung, die ich sowohl aus meiner langen Dienstzeit in NRW als auch aus meiner Arbeit in verschiedenen Gremien (DFV/AGBF/FNFW) mitbringen konnte, war sicherlich ein zusätzlicher Gewinn für diesen Prozess.
Behörden Spiegel: Wie ist Ihr Amt aufgebaut?
Schubert: Das Landesamt wurde zum 1. Januar gegründet, nachdem das Errichtungsgesetz am 11. Juli des vergangenen Jahres im Landtag von Rheinland-Pfalz einstimmig beschlossen worden war. Das ist ein sehr wichtiges Signal und unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung.
Im Vergleich zur alten Struktur, bei der die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) und das Referat 22 der ADD nebeneinander agierten, wurden die Bereiche nun zusammengefasst. Zum Beispiel ist die ehemalige Akademie nun eine eigenständige Abteilung. Technik-Themen wurden in die Abteilung Technik zusammengeführt, während viele der Aufgaben des ehemaligen Referats 22 sowohl im Planungsreferat als auch im Krisenmanagementreferat zu finden sind. Diese Strukturen sind derzeit im Aufbau und bilden die Grundlage für die kommenden Jahre.
Die einzelnen Aufgabenbereiche sind bereits strukturiert. Dazu gehören unter anderem Stabsstellen, wie der Leitungsstab, in dem auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit integriert ist. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Zivile Verteidigung. Hier müssen wir als Behörde nicht nur die Zivilschutzaspekte des Bevölkerungsschutzes behandeln, sondern auch sicherstellen, dass wir im Krisenfall selbst handlungsfähig bleiben.
Die Abteilung P ist mit den Themen Risikomanagement und Vorplanung betraut. Hier werden Verfahren zur Risikoanalyse entwickelt und gleichzeitig die kommunale Gemeinschaft unterstützt sowie die Aufsicht über die Bedarfs- und Entwicklungspläne übernommen. In Zukunft werden Feuerwehrbedarfspläne und Katastrophenschutzbedarfspläne in den Gemeinden und Kreisen erstellt, die fachlich abgestimmt werden müssen. Dazu gehört auch die Zivilschutzplanung, die Beratung zu Kritischer Infrastruktur und die Sensibilisierung der Bevölkerung. Darüber hinaus entwickeln wir auch die Fähigkeit, Ereignisse auszuwerten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen – und das nicht nur für Ereignisse in Rheinland-Pfalz, sondern auch überregional.
Hinter diesem neuen Aufbau steht ein umfassendes gutachterliches und als Projekt erarbeitetes Gesamtkonzept, das die Leitlinie für die Landesverwaltung darstellt. Es geht davon aus, dass der Personalaufbau bis 2030 auf etwa 300 Vollzeitäquivalente ansteigt – also mehr als eine Verdopplung der alten Personalstruktur. Derzeit sind wir sehr intensiv mit Personalentwicklungsmaßnahmen beschäftigt, um diese Zielsetzung zu erreichen.
Auf unserem Gelände besteht jedoch aktuell ein erheblicher Liegenschaftsmangel. Wir entwickeln daher zügig neue Funktionen in bestehenden Gebäuden und neue Gebäude, um die wachsenden Funktionalitäten unterbringen zu können, was parallel zur Ausbildungsoffensive verläuft.
Behörden Spiegel: Sie haben den operativen Dienst schon zum Jahreswechsel mit dem Lagezentrum begonnen. Was ist das Besondere daran?
Schubert: Das Lagezentrum ist ein zentrales Element der Neuausrichtung. Eine Besonderheit hierbei ist, dass wir vor dem 1. Januar bereits mit dem Betrieb des Lagezentrums begonnen haben. Es wurde baulich bereits abgeschlossen und ist seit Herbst letzten Jahres im Dienstbetrieb. Der Betrieb wird nun ab Sommer 2025 in einen 24/7-Betrieb überführt.
Das Lagezentrum ist auf Landesebene eine absolute Neuerung. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die solche Aufgaben meist in den Lagezentren ihrer Innenbehörden integrieren, die überwiegend polizeiliche Aufgaben abbilden, haben wir in Rheinland-Pfalz ein eigenes Zentrum für den Bevölkerungsschutz.
Behörden Spiegel: Kann das LfBK in die Einsatzleitung eingreifen?
Schubert: Sie blicken bereits auf die Neufassung des Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG). Das derzeitige LBKG ermöglicht es uns als Land, die Einsatzleitung zu übernehmen, jedoch nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Zukünftig wird es so sein, dass ein Kreis, der feststellt, dass er mit der Lage überfordert ist, die Unterstützung des Landes anfordern kann, sodass das Landesamt die Einsatzleitung übernimmt. Ebenso wird die Übernahme der Einsatzleitung insbesondere dann relevant, wenn eine flächendeckende Lage vorliegt, bei der mehrere Kreise betroffen sind.
In solchen Fällen müssen die verfügbaren Ressourcen auf Landesebene gezielt gesteuert werden – nicht nach dem Prinzip „wer zuerst ruft, bekommt alles“, sondern im Sinne einer übergeordneten bedarfsgerechten Koordination. Ein weiterer Fall tritt ein, wenn wir feststellen, dass eine örtliche Struktur überfordert ist. In diesem Fall können wir ebenfalls die Einsatzleitung übernehmen. Der vierte Fall, der sehr spezifisch ist, betrifft komplexe Strahlenschutz-unfälle, die auch heute bereits unter diese Regelung fallen.
Behörden Spiegel: Wie ist es um die Durchhaltefähigkeit des Amtes bestellt?
Schubert: In Kürze ist das Lagezentrum personell so aufgestellt – die letzten Einstellungen erfolgen aktuell – dass ein 24/7-Betrieb mit drei durchgängig besetzten Funktionen dauerhaft möglich ist.
Für alle weiteren Aufgaben, die wir mit unseren Einsatzfunktionen abdecken, haben wir zudem den großen Vorteil, dass wir auf den gesamten Personalkörper des Landesamtes zurückgreifen können. Das war auch ein wesentlicher Gedanke hinter der Entscheidung, die Personalkörper der Akademie und des Referats 22 der ADD zusammenzuführen. So kann beispielsweise eine Person, die im Alltag vorwiegend in der Lehre tätig ist und nur gelegentlich in der Rufbereitschaft eingesetzt wird, bei einer größeren oder langanhaltenden Lage vollständig in den Einsatz eingebunden werden. Die Lehrtätigkeit tritt dann temporär in den Hintergrund.