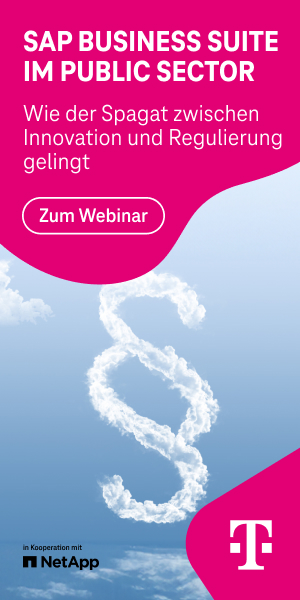Nach langem Streit ist die Koalition zu einer Einigung gekommen. Der neue Wehrdienst bleibt seinem Wesen nach freiwillig. Verpflichtende Elemente bedürfen einer zusätzlichen Abstimmung im Bundestag.
Mit dem Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG) hat die Debatte um die Wiedereinführung des Wehrdienstes einen vorläufigen Abschluss gefunden. Nach derzeitigen Planungen soll das WDModG zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Mit dem nach dem schwedischen Modell gestalteten Konzept plant das Verteidigungsministerium (BMVg), bis zum Jahr 2035 mindestens 260.000 Männer und Frauen zum Dienst in der Truppe zu motivieren. Das entspricht einem Zuwachs von 80.000 Kräften. Zudem soll es 200.000 Reservistinnen und Reservisten geben. Beschlossene Sache ist das Gesetz allerdings noch nicht. Der Bundestag wird voraussichtlich Anfang Dezember über den Gesetzentwurf beraten. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist der Überzeugung, dass ein Aufwachsen der Truppe alternativlos ist. Die internationale Sicherheitslage, vor allem das aggressive Auftreten Russlands, erforderten dies.
Der Fragebogen für alle
Konkret sieht der neue Wehrdienst vor, dass alle 18-jährigen Frauen und Männer einen Fragebogen erhalten. Dieser fragt ab, ob sie den Wehrdienst absolvieren wollen und sich dafür geeignet sehen. Das umfasst Fragen, ob ein grundlegendes Interesse am Wehrdienst besteht, die Körpergröße und das Gewicht, ob eine Schwerbehinderung oder entsprechende Gleichstellung vorliegt, die Bildungsabschlüsse sowie sonstige Befähigungen und Qualifikationen, eine Selbsteinschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie ob bereits ein Wehrdienst in fremden Streitkräften geleistet wurde. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend. Darüber hinaus ist für die männlichen Anteile des Geburtsjahres 2008 auch die Musterung verpflichtend. Das beginnt ab dem 1. Juli 2027. Bei der Definition, wann eine Person als männlich gilt, orientiert sich das BMVg an dem bei den Meldebehörden hinterlegten Geschlechtseintrag.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden die geeignetsten Freiwilligen eines Jahrgangs zu einem sogenannten Assessment eingeladen. Neben der Eignung wird in diesem Rahmen zusätzlich erörtert, wo die betroffene Person am ehesten zum Einsatz kommen könnte. Den rechtlichen Rahmen, um sich mit dem Fragebogen an die potenziellen Wehrdienstleistenden zu wenden, plant die Bundesregierung durch Änderungen in § 15 des Wehrpflichtgesetzes. Sollte der Bundestag seine Zustimmung erteilen, ist es dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr künftig erlaubt, nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die notwendigen Daten abzufragen.
Für die Organisation der Musterung zeichnen die bestehenden Karrierecenter der Bundeswehr verantwortlich. Zusätzlich sollen sogenannte Musterungszentren entstehen. Die abgeschafften Kreiswehrersatzämter gehen nicht wieder in Betrieb. Bei der Gestaltung der Musterungszentren verspricht das BMVg eine helle und freundliche Atmosphäre.
Wo die Freiwilligkeit endet
Sollte es allerdings nach diesem Modus nicht gelingen, den gesetzlich festgehaltenen Korridor der Aufwuchszahlen bis 2035 zu erreichen, kann es zu einer sogenannten Bedarfswehrpflicht kommen. Dafür ist allerdings eine Abstimmung im Bundestag erforderlich. In diesem Rahmen stimmen die Volksvertreterinnen und Volksvertreter ebenfalls darüber ab, ob die brachliegenden Personalbedarfe per Losverfahren gedeckt werden sollen. Das Verteidigungsministerium stellte allerdings klar, dass dieses Verfahren erst als Ultima Ratio greifen soll. Einen Automatismus zur Wiedereinführung der Wehrpflicht – so stellte das BMVg klar – werde es nicht geben.
Die Regierung gibt sich flexibel
Um möglichst viele junge Menschen zu einem freiwilligen Wehrdienst zu motivieren, möchte die Regierung den Neuen Wehrdienst möglichst attraktiv gestalten. Dazu gehört eine Vergütung von mindestens 2.600 Euro brutto im Monat. Bisher verdienen Soldatinnen und Soldaten im freiwilligen Wehrdienst zwischen 1.800 und 2.200 Euro im Monat. Zudem sind Zuschüsse für den Pkw- oder Lkw-Führerschein vorgesehen, wenn sich eine Soldatin oder ein Soldat für mindestens ein Jahr verpflichtet. Die Unterstützungsleistungen können bis zu 3.500 Euro umfassen. Flexibel geht es hingegen bei den Zeiträumen der Verpflichtung zu. Die Mindestdauer beträgt sechs Monate. Darüber hinaus ist die Dauer individuell anpassbar. Bei entsprechender Eignung sind Verpflichtungszeiten von bis zu 25 Jahren möglich. Allerdings wechseln Wehrdienstleistende nach zwölf Monaten vom Status des Freiwillig Wehrdienstleistenden zum Soldaten bzw. zur Soldatin auf Zeit (SaZ).
Mit dem neuen Status geht auch eine höhere Vergütung einher: mindestens 2.700 Euro brutto im Monat. Bei der Wahl des Dienstortes strebt das BMVg an, Umzüge möglichst zu vermeiden. Auszuschließen sind diese allerdings nicht, insbesondere wenn die geplante Verwendung nur an bestimmten Orten in der Bundesrepublik erfolgen kann.