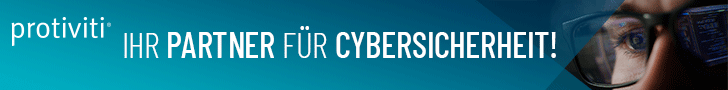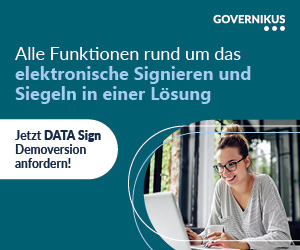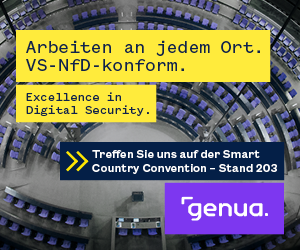Auf dem Defence Day des Behörden Spiegel wagte Professor Sönke Neitzel, Inhaber des Lehrstuhls für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, den Blick zurück. Gemeinsam mit dem Behörden Spiegel analysiert er 40 Jahre Bundeswehr-Geschichte.
1985 stand die Bundeswehr laut Neitzel auf dem Höhepunkt ihrer Kampfkraft. Das Heer verfügte über zwei Heimatschutzbrigaden und 36 Kampfbrigaden. Positiv waren auch die Entwicklungen bei der Marine und der Luftwaffe. Diese Fähigkeiten waren der damaligen Bundesregierung viel Geld wert. Etwa drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) flossen jährlich in die Verteidigung. Folgerichtig war zu diesem Zeitpunkt erstmals Hoffnung in der Truppe zu spüren, dass die Bundeswehr einem Angriff des Warschauer Paktes standhalten könne. Die Meinungen, ob die Truppe auch einem zweiten Aufmarsch gewachsen sei, waren hingegen gespalten. Insgesamt blieb das Stimmungsbild aber positiv.
Doch auch damals, auf dem Höhepunkt der bundesdeutschen Verteidigungsfähigkeit, habe es strategische Herausforderungen gegeben. Die Munitionsvorräte der Bundeswehr waren bereits in den 1980er Jahren bestenfalls für zehn Tage ausreichend. Zusätzlich trieb der Blick in die Zukunft den Verantwortlichen Sorgenfalten auf die Stirn. Durch den Pillenknick nahmen die Geburtskohorten ab. Die Bundeswehr stellte sich darauf ein, die Truppengröße von 495.000 auf 425.000 Mann zu reduzieren.
Neue Herausforderungen der Bw 2.0
Mit der Deutschen Einheit und dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion fand sich die Bundeswehr aber in einer neuen Realität wieder. Die Bundeswehr 1.0 habe laut Neitzel im Jahr 1985/86 ihren Höhepunkt gefunden – ein Prozess, der seit der Wiederbewaffnung der Bundeswehr 30 Jahre in Anspruch genommen habe. In den 90ern jedoch stand die Truppe – jetzt in der Iteration 2.0 – völlig neuen Herausforderungen gegenüber. Das Gefecht fand nicht mehr in der norddeutschen Tiefebene, sondern out of area statt. Statt als demokratischen Soldat mussten die Bundeswehrangehörigen nun als Peacekeeper auftreten. Eine grundsätzliche Abkehr von der Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) blieb in den 90er Jahren allerdings noch aus.
Weil zur Doppelbelastung noch Budgetkürzungen hinzukamen, sei die Bundeswehr heillos überfordert gewesen, bilanzierte der Historiker. Ab 2001, mit dem Beginn des Afghanistan-Einsatzes, wurde der LV/BV-Anteil endgültig zur Formalie reduziert. Gleichzeitig rückten die Bundeswehr und die Gesellschaft näher zusammen als je zuvor. Mit den Friedenswächtern in Uniform hätten sich große Teile der Bevölkerung anfreunden können. Neitzel versteht diesen Moment als Höhepunkt einer in den 90er Jahren angestoßenen Entwicklung. „Die Bundeswehr wurde zunehmend als innenpolitisches Projekt wahrgenommen“, so der Professor. Das Militärische trat dabei in den Hintergrund. Als erfolgreich wurde das Projekt Bundeswehr nämlich dann angesehen, wenn es innenpolitisch gut integriert war und außenpolitisch zum Prestige der Bundesrepublik beitrug.
Die Dynamiken hin zu einer auf das Internationale Krisenmanagement (IKM) ausgerichteten Streitkraft fanden laut Neitzel 2011 mit dem Dresdner Erlass ihre Vollendung
2014 beginnt ein neues Kapitel
Drei Jahre später geht die IKM-Periode der Bundeswehr mit der russischen Besetzung der Krim zu Ende. Fortan ist LV/BV erneut das Primat. Die deutschen Streitkräfte befanden sich zu diesem Zeitpunkt allerdings auf dem Tiefpunkt ihrer Leistungsfähigkeit. „Hätte Russland im Jahr 2014 das Baltikum angegriffen, wäre die Bundeswehr nicht einmal in die Region gekommen“, monierte Neitzel. Mit dem Wissen um die bisherigen Zeiträume, welche die Bundeswehr für ihre Transformationsprozesse in Anspruch nahm, ging der Historiker davon aus, dass die deutschen Streitkräfte Mitte der 2030er Jahre wieder LV/BV leisten könnten. Für Neitzel ist klar: „Wir müssen Fahrt aufnehmen.“ Denn ließe man sich bis ins Jahr 2035 Zeit, sende dies kein Zeichen der Entschlossenheit an Putin. Eine ernstzunehmende Reform der deutschen Streitkräfte bedürfe aber politischer Rückendeckung.
„Eine Reform der Bundeswehr kann nur als Kabinettsprojekt umgesetzt werden“, machte Neitzel deutlich. Die letzten drei Verteidigungsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Christine Lambrecht (SPD) und Boris Pistorius (SPD), mussten aber genau auf diese Unterstützung verzichten. Folgerichtig versteht Neitzel es als eine der Kernaufgaben der neuen Bundesregierung, eine Bundeswehrreform als Kabinettsprojekt umzusetzen. Der Behörden Spiegel wird die Entwicklungen redaktionell begleiten