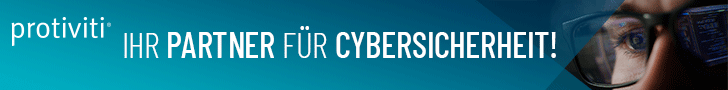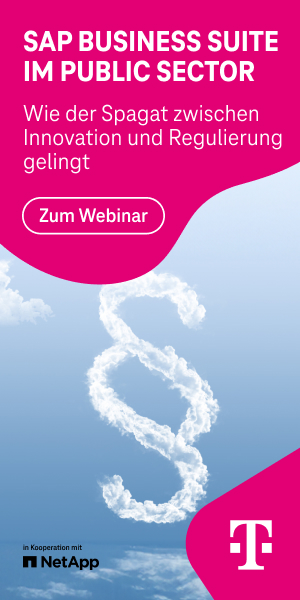Nach viel Ringen hat sich die schwarz-rote-Koalition auf ein neues Wehrdienstmodell geeinigt. Das große Vorbild Schweden fand in der deutschen Lösung weniger Beachtung als zunächst angekündigt.
Frisch aus der Sommerpause zurück, wandte sich die schwarz-rote Koalition einem politischen Schwergewicht zu: der Gestaltung des neuen Wehrdienstes. Fragen um dessen Umfang und den Grad der Freiwilligkeit spalteten die Koalitionspartner. Der nun gefundene Kompromiss orientiert sich an einem skandinavischen Modell. Allerdings ist die deutsche Lösung an vielen Stellen großzügiger als das Vorbild aus Schweden.
Am 27. August einigte sich die Bundesregierung im Bendlerblock des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) auf den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes (WDModG). Damit verfolgt die Regierung um Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vornehmlich das Ziel, den Aufwuchs der Reserve zu stärken. Das soll überwiegend freiwillig gelingen. Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass alle Männer und Frauen ab ihrem 18. Geburtstag einen Fragebogen auf QR-Code-Basis erhalten, in dem persönliche Daten, Qualifikationen sowie die Bereitschaft zu einem Dienst bei der Bundeswehr erfragt werden. Die Abfrage wird mit dem Jahrgang 2008 beginnen. Für Männer ist das Ausfüllen verpflichtend. Auf Basis einer digitalen Auswertung der Rückmeldungen werden die Rekrutinnen und Rekruten zu einem Assessment eingeladen. Ab dem 1. Juli 2027 ist eine Verschärfung vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Musterung für Männer verpflichtend. Die letztendliche Verpflichtung bleibt aber auch nach der Verschärfung weiterhin freiwillig.
Mehr Gestaltungsmöglichkeiten
Bei der Gestaltung des Wehrdienstes räumt der Gesetzgeber den Soldatinnen und Soldaten mehr Freiraum ein, als das bei älteren Modellen der Fall war. Ab ihrem Dienstbeginn werden alle Soldatinnen und Soldaten in den Status eines Soldaten auf Zeit berufen. Ihre Dienstzeit können sie frei wählen. Im Rahmen des neuen Wehrdienstes steht ein Zeitraum zwischen mindestens sechs und bis zu 23 Monaten zur Auswahl. Längerdienende Zeitsoldatinnen und -soldaten können ihren Dienst auf bis zu 25 Jahre ausdehnen. Aus der Länge der Verpflichtung ergeben sich die Lehrinhalte. Zunächst durchlaufen alle Neuverpflichteten eine einheitliche Ausbildung zum Wach- und Sicherungssoldaten und werden zum erweiterten Heimatschutz befähigt. Ab einer Verpflichtungszeit von einem Jahr erfolgt darüber hinaus eine Ausbildung in den aktiven Strukturen der Teilstreitkräfte. Darunter fällt zum Beispiel die Ausbildung an den jeweiligen Waffensystemen.
Sollten die vorgesehenen Maßnahmen nicht genügen, um den angestrebten Personalaufwuchs zu erzielen, hat sich die schwarz-rote Koalition eine Option zur verpflichtenden Heranziehung vorbehalten. Sollte die sicherheitspolitische Situation dies verlangen, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages die Einberufung des Grundwehrdienstes beschließen. Um die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, hat die Bundesregierung sich neben dem Wehrdienstmodell auch auf eine Novellierung der Wehrerfassung und Wehrüberwachung geeinigt. Der Gesetzentwurf schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Jahrgänge ab 2008 zu erfassen und entsprechendes Material zu versenden. Um schon unterhalb der verpflichtenden Maßnahmen genug Rekrutinnen und Rekruten zu motivieren, möchte die Regierung unter Merz den Wehrdienst attraktiver gestalten. Neben einer „attraktiven“ Besoldung soll das vor allem durch Verpflichtungsprämien und individuelle Fortbildungsmaßnahmen geschehen. Darunter fallen zum Beispiel Sprachkurse, bezuschusste Führerscheine oder die Arbeit mit Hochtechnologie.
Schweden setzt stärker auf Zwang
Der von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erarbeitete Modus Operandi ist weniger stringent als das schwedische Modell, das ihm als Vorbild diente. Zwar gleichen sich beide Vorgehensweisen darin, einen Fragebogen zur verpflichtenden Bearbeitung an die volljährigen Männer eines Jahrgangs zu schicken, allerdings können sich die im Nachgang ausgewählten Männer im hohen Norden dem Wehrdienst nicht mehr entziehen. In Schweden trifft dieses Vorgehen nur selten auf Unmut. Die Mehrzahl der Ausgewählten entscheidet sich freiwillig für den Wehrdienst. Dazu trägt das hohe Ansehen der Streitkräfte im Land bei. Außerdem werden im Wehrdienst viele Fähigkeiten vermittelt, die auch in der Wirtschaft attraktiv sind.
Der GI will im Zweifel nachsteuern
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, zeigt sich mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Modell zufrieden. Er erläutert an einem Rechenbeispiel, warum er das aktuelle Modell für auskömmlich erachtet.
Entsprechend der NATO-Planung belaufe sich der Verteidigungsumfang in Deutschland auf 460.000 Soldatinnen und Soldaten. Über 183.300 Bundeswehrangehörige verfügten die deutschen Streitkräfte zurzeit. Hinzukämen 60.000 Männer und Frauen in der Beorderungsreserve sowie weitere 100.000 nicht erfasste Reservistinnen und Reservisten. Bis zum Inkrafttreten des neuen Wehrdienstes durchlaufen pro Jahr 15.000 Soldatinnen und Soldaten die Ausbildung. Ab 2026 seien es pro Jahrgang noch 3.000 mehr. Das genüge, um die Planungsziele zu erfüllen. Eine vollumfängliche Wehrpflicht hätte hingegen zur Folge, dass viele Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst sich fortan der Ausbildung zuwenden müssten. Es gelte entsprechend, eine Balance zwischen hoher Einsatzbereitschaft und Aufwuchspotenzial zu finden. Das jetzt beschlossene Modell genüge diesem Anspruch. Sollten sich die Bedarfe aufgrund anderer sicherheitspolitischer Rahmenbedingungen ändern, müsse der Gesetzgeber entsprechend mit verpflichtenden Anteilen nachsteuern.