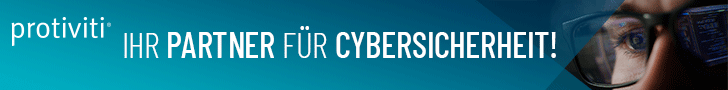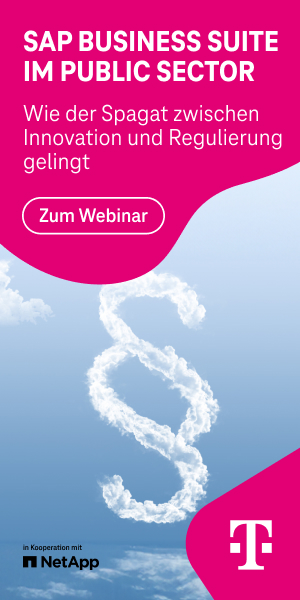Mit dem Deutschlandticket kann man bekanntermaßen überall in der Bundesrepublik den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Jedoch gehört in manchen Städten mehr dazu als die klassischen Fortbewegungsmöglichkeiten wie Bus und Bahn.
So kann man beispielsweise Hamburg auch per Fähre entdecken. Die umweltfreundliche Alternative zum üblichen Straßen und Schienenverkehr leiste sowohl Pendlerinnen und Pendlern als auch Gästen der Stadt gute Dienste, indem sie über und entlang der Elbe zwischen Blankenese, Finkenwerder und der HafenCity Verbindungen schaffe: Wie die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende Hamburg (BVM) erklärt, sei die HADAG Seetouristitk und Fährdienst AG bereits seit 1888 ein zentraler Bestandteil des Hamburger öffentlichen Nahverkehrs und befördere jährlich 8,5 Millionen Fahrgäste.
Dabei sei die Technik aber nicht im Jahrhundert stehen geblieben, denn „besonders hervorzuheben ist die kontinuierliche Modernisierung der Flotte, bei der großer Wert auf emissionsarme Antriebstechnologien gelegt wird. So wurde im September 2024 die erste von drei neuen Hybridfähren in den Dienst gestellt und es ist geplant, die Flotte in den kommenden Jahren um weitere umweltfreundliche Schiffe zu erweitern“, erläutert das BVM. Damit trügen die Fähren nicht nur zu einer Verkehrsberuhigung bei, da Hamburg von zahlreichen Wasserwegen geprägt sei, sondern führten auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität in der Hansestadt.
Nicht nur zu Wasser unterwegs
Übers Wasser ist aber nicht der einzige Weg, auch in der Luft kommt man gut voran, z. B. mit der Wuppertaler Schwebebahn. Die sogenannte „Einschienenhängebahn“ ist laut den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) ein weltweit einzigartiges Stadtbahnsystem, das sich mit 20 Stationen über 13,3 Kilometer durch alle Innenstadtbereiche schlängelt. Da sie im Gegensatz zu einer einfachen Straßenbahn keine Ampeln oder dergleichen zu beachten hat, kann die Schwebebahn in enger Taktung von fünf Uhr morgens bis 23 Uhr Abends Fahrgäste transportieren. „Mit rund 60.000 Fahrgästen am Tag stellt die Schwebebahn täglich unter Beweis, dass sie das wichtigste Verkehrsmittel im ÖPNV der 350.000-Einwohner-Stadt im Bergischen Land ist“, erklären die WSW stolz. Die seit 1901 fahrende Schwebebahn ist zudem auch das Wahrzeichen der Stadt.
Blick ins Ausland
Ebenfalls hoch hinaus bei der Fahrt durch die Stadt geht es mit Seilbahnen. Wie auch die Wuppertaler Schwebebahn sind diese Verkehrsmittel nicht an Ampeln gebunden und besonders gut dafür geeignet, Flüsse oder Höhenmeter zu überwinden. So ist es kein Wunder, dass die bolivianische Hauptstadt La Paz mit ihren großen Höhenunterschieden über mehrere Linien und eine Netzlänge von über 30 Kilometern verfügt. Ein so eindrucksvolles Netz ist in deutschen Städten in der Regel nicht vonnöten, um Höhenunterschiede zu überwinden. Dennoch gibt es in Städten wie Koblenz Seilbahnen, die auch für den täglichen Pendlerverkehr genutzt werden. In den öffentlichen Personennahverkehr integriert sind diese Angebote jedoch nicht, sodass eine Fahrt immer eines zusätzlichen Tickets bedarf.
Anders soll es bei der in Bonn geplanten Seilbahn sein. Sie wird in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bonn umgesetzt, die einen Kooperationsvertrag mit der Stadt für das Seilbahn-Projekt geschlossen haben. Nach Aussagen der Stadtverwaltung soll mit den geplanten Stationen auf beiden Rheinseiten eine optimale Anbindung an den Nah- und Regionalverkehr gewährleistet sein. Wenn die angestrebten Ziele zu einer Fertigstellung der Unterlagen zur Planfeststellung bis Mitte 2026 eingehalten werden, könnte die Seilbahn noch vor 2030 an das Verkehrsnetz der Bundesstadt angebunden werden. Der Bau der Seilbahninfrastruktur wird nach Berechnungen 66 Millionen Euro kosten. Der größte Teil der Investitionen kann über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden. Für die Stadt Bonn würde ein ungefährer Eigenanteil von elf Millionen Euro verbleiben. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass eine abschließende Kostenprognose erst nach Fertigstellung der Planung abgegeben werden kann. Nach bisheriger Expertenmeinung würde die Seilbahn einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität der Stadt leisten. Zusätzlich soll sie die vielbefahrene Straße zu Bonns drittgrößtem Arbeitgeber, dem Universitätsklinikum auf dem Venusberg, entlasten.
Schienenergänzungsmittel
Die Möglichkeiten von Fähre, Schwebe- und Seilbahn beschränken sich aber hauptsächlich auf den innerstädtischen Transport. Davon haben ländlichere Regionen oder kleinere Städte und Dörfer wenig. In Zukunft kann sich das mit den sogenannten „Monocabs“ ändern. Dabei handelt es sich ebenfalls um Einschienenbahnen, die bereits vorhandene, stillgelegte Bahnschienen nutzen sollen. Dabei ist eine Schiene für den Hinweg gedacht, die andere für den Rückweg. In den kleinen Kabinen finden vier bis sechs Personen Platz und auch eine Fahrradmitnahme ist bei wenigen Personen möglich. Die autonom fahrenden Kabinen sollen für mehr Mobilitätsgerechtigkeit und Lebensqualität in ländlichen Regionen sorgen. Hinter dem Forschungsprojekt stehen die Technischen Hochschule OWL, die Hochschule Bielefeld und das Fraunhofer IOSB-INA. 2023 bewies ein Testfahrzeug, dass die Idee funktioniert und 2028 soll eine erste langfristige Testphase erfolgen. Ob Monocabs in der Zukunft deutschlandweit zum Einsatz kommen und auch international Anklang finden, wie es sich die Hersteller erhoffen, bleibt abzuwarten.