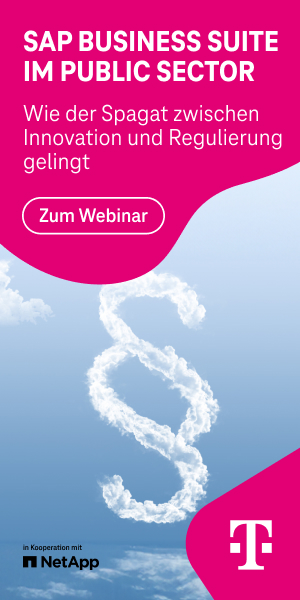In Zukunft sollen Rechenzentren grünen Strom beziehen und energieeffizient im Betrieb sein. Neue Rechenzentren müssen zudem ein Fünftel ihrer Abwärme abgeben. Tausende von Haushalten könnten so versorgt werden. Um diese Chance zu nutzen, fehlen noch die richtigen Strukturen.
Streaming, Cloud, Künstliche Intelligenz (KI) – die fortschreitende Digitalisierung bedeutet zugleich einen stark erhöhten Stromverbrauch in den Rechenzentren, die die Technologien betreiben. Viele machen sich daher darüber Gedanken, wie Rechenzentren effizienter und nachhaltiger gestaltet werden können. Einer davon ist Professor Peter Radgen. Seit einigen Jahren forscht er zu genau diesem Thema am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energienutzung (IER) der Universität Stuttgart. Gleichzeitig ist er Vorstandsmitglied in der German Datacenter Association (GDA). Für die ökologische Nachhaltigkeit von Rechenzentren spielen ihm zufolge die Hardware und der Bau der Gebäude eine Rolle. Der wesentliche Aspekt sei jedoch der Betrieb.
Das im November letzten Jahres in Kraft getretene Energieeffizienzgesetz (EnEfg) schreibt vor, dass Rechenzentren ab 2027 ihren Strom aus Erneuerbaren Energien beziehen müssen. In geringem Maße könne der Strom durch Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Rechenzentren erzeugt werden, allerdings gebe es dort wenig Platz, erläutert Radgen. Je nach Lage der Rechenzentren könne die Energie standortnah erzeugt werden. In der Realität fänden die Erzeugung und der Verbrauch aber häufig weit voneinander entfernt statt, teilt eco – der Verband der Internetwirtschaft e.V. mit. Weiterhin sei die Verfügbarkeit von Windkraft und Photovoltaik über die Zeit nicht konstant, weswegen die Speicherung der Energie an Bedeutung gewinnen. Und: Stand heute könne der verfügbare grüne Strom nicht den Bedarf aller Rechenzentren in Deutschland decken.
Das Energieeffizienzgesetz (EnEfg) legt auch fest, wie hoch der PUE-Wert ausfallen darf. Dieser beschreibt das Verhältnis zwischen dem Gesamtenergieverbrauch eines Rechenzentrums und dem Energieverbrauch der IT-Ausstattung. Kurz: wie energieeffizient ein Rechenzentrum arbeitet. Neue Rechenzentren dürfen ab 2026 einen PUE-Wert bis maximal 1,2 haben. Bei bestehenden Rechenzentren darf dieser ab 2027 maximal 1,5 und ab 2030 1,3 betragen. Zum Vergleich: Um das Umweltzeichen „Blauer Engel“ zu erhalten, darf der PUE-Wert bei maximal 1,3 liegen. Die Kriterien des EnEfg sind also streng.
Was es für die Nutzung der Abwärme braucht
Eine der effektivsten Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit ist die Nutzung der großen Menge an Abwärme, die beim Betrieb des Rechenzentrums entsteht, informiert Kilian Wagner, Referent für nachhaltige digitale Infrastrukturen beim Bitkom. Mit der Abwärme können Lagerhallen, Büros oder private Wohnungen beheizt werden. Bisher bleibt sie aber oft ungenutzt. Grund dafür sind eine Reihe an Herausforderungen. Erstens gibt es einen Temperaturunterschied: Die heutigen Wärmenetze arbeiten typischerweise bei 110 Grad, die Abwärmetemperatur der Rechenzentren liegt ungefähr bei 35 Grad. „Daher braucht es immer eine Wärmepumpe, um die Temperatur anzuheben. Je höher der Temperaturursprung ist, umso ineffizienter wird das und wirkt sich somit negativ auf die Kosten der Wärmebereitstellung aus“, erklärt Professor Radgen. Zweitens bekomme man die Abwärme nur im Winter weg, nicht im Sommer. Und auch dann habe man nicht den gesamten Winter die maximale Last, da unterschiedlich geheizt werde. Drittens gibt es einen Standortkonflikt: Um die Abwärme zu nutzen, müsste man die Rechenzentren in die Ballungsräume stellen, dort, wo Wohnungen sind. Eigentlich sollen sie aber am Rande, in Industriegebieten, stehen, weil sie über die Rückkühlanlagen ein bisschen Lärm verursachen.
Riesige Mengen
Das Energieeffizienzgesetz macht auch hier klare Vorgaben: Rechenzentren, die ab dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, müssen zunächst zehn Prozent ihrer Abwärmemenge abgeben. Ab 2028 sind es 20 Prozent. „Wir haben Berechnungen gemacht, die zeigen, dass diese Grenzwerte nur im optimalsten Fall erreicht werden können und das auch nur bei kleineren Rechenzentren. Bei größeren Rechenzentren ist die Chance, dass das gelingen kann, relativ klein“, verdeutlicht Radgen. Schließlich geht es dabei zum Teil um „riesige Mengen“ von fünf MW und mehr. Die Rechenzentren wollen ihre Abwärme abgeben – aber wer soll sie annehmen? Um genau diese Frage zu beantworten, baut das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Plattform für Abwärme auf. Hier können Kommunen in Zukunft Wärmequellen einsehen, sodass Partnerschaften entstehen können.
Den Verbänden reicht das nicht. Sie finden, es brauche verbesserte Rahmenbedingungen für mehr Abnehmer der Abwärme. Vor allem müssten die Nah- und Fernwärmenetze ausgebaut werden. Während eco eine Abnahmeverpflichtung für Wärmenetzbetreiber befürwortet, spricht sich die German Datacenter Association für eine Verpflichtung zur Schaffung der benötigten Voraussetzungen für die Abwärmenutzung aus, nicht aber für eine garantierte Abnahmeverpflichtung. „Man muss versuchen, Anreize zu setzen, dass die Wärme tatsächlich genutzt wird“, bringt es der Professor für Energieeffizienz auf den Punkt. Für die Rechenzentren dürfe die Abwärmenutzung kein großes Verlustgeschäft darstellen.
Im öffentlichen Sektor stehen zwar die finanziellen Gewinne nicht im Fokus. Dafür gibt es andere Hürden. „Um Abwärme abzugeben, brauche ich erstens den Anschluss ans Fernwärmenetz und zweitens Abnehmer. Das muss man auf vertragliche Füße stellen. Und das ist im öffentlichen Bereich und über föderale Ebenen hinweg nicht immer ganz einfach“, berichtet Holger Lehmann, Leiter des Projekts operative IT-Konsolidierung (ProITK) beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund). Er kann trotzdem von zwei Erfolgsbeispielen berichten: So versorge in Frankfurt eins der ITZBund-Rechenzentren mit seiner Abwärme das eigene Bürogebäude. Ein anderes Rechenzentrum in Frankfurt soll seine Abwärme an eine Kommune abgeben. In dem Fall regele das der privatwirtschaftliche Betreiber des Rechenzentrums, welches das ITZBund miete. Lehmann meint außerdem: „Wir sind dankbar für die gesetzliche Vorgabe. Sie ermöglicht klares Agieren gegenüber dem Markt.“ Auch könnten damit Haushaltsmittel angeworben werden. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass die Bedeutung von öffentlichen Rechenzentren im Vergleich zu den privatwirtschaftlichen gering sei.
Der grüne Norden
In Schleswig-Holstein befindet sich die 2023 verabschiedete Green-IT-Strategie in einer „intensiven Umsetzungsphase“, informiert die Staatskanzlei. Teil davon seien Gespräche mit der Wirtschaft, wie von deren Seite die Abwärme aus den Rechenzentren genutzt werden könne. Bei der Infrastruktur für die Landes-IT ist das schon Realität: Schleswig-Holstein betreibt einen Großteil der zentralen IT bei Dataport in einem Rechenzentrum der Firma Akquinet an zwei Standorten. Mit seiner Abwärme werden eine Turnhalle und Büroräume beheizt. Der PUE-Wert liege bei 1,23 und damit „bereits seit einigen Jahren“ unterhalb des geforderten Werts von 1,3. Zudem erfolge die Stromversorgung zu 100 Prozent durch Erneuerbare Energien.
Diese positiven Beispiele zeigen, wie Rechenzentren nachhaltiger werden und gleichzeitig die Wärmewende unterstützen können – wenn die Voraussetzungen dafür stimmen.