Lange Hitzeperioden, wenig Niederschlag, trockene Böden. Wie Forstverwaltungen den Wald an den Klimawandel anpassen sollten, erklärt Prof. Dr. Pierre Ibisch, Professor für Sozialökologie der Waldökosysteme an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Die Fragen stellte Anne Mareile Moschinski.
Behörden Spiegel: Die sich verändernden klimatischen Bedingungen bringen auch das Ökosystem Wald durcheinander. Was können Forstverwaltungen tun, um Schäden abzumildern und wie sollte ein „Umbau“ unserer Wälder aussehen?
Prof. Dr. Pierre Ibisch: Zunächst einmal: Wälder kann man nicht umbauen. Viele konventionelle Herangehensweisen an die Waldbewirtschaftung funktionieren nicht mehr. Vielfach wurden und werden Wälder als Plantagen gepflanzt, um sie effizient zu betreiben. Das hat uns große Probleme eingebracht: Wir haben dadurch sogenannte Altersklassewälder bekommen – alle Bäume sind gleich alt. Große Waldflächen sind homogen und vulnerabel gegen Störungen aller Art, erst recht in der aktuellen Klimakrise. Vor dem Hintergrund unserer Kenntnisse ist es fahrlässig, den Anbau einer Baumart, die hierzulande gerade scheitert – wie die Fichte – durch andere, vermeintlich robustere Nadelbäume zu ersetzen, die hier nicht heimisch sind, wie die Douglasie oder die japanische Lärche. Da werden die „Kalamitätswälder“ von morgen gepflanzt.

Behörden Spiegel: In vielen Regionen sind Forstverwaltungen dazu angehalten, Mischwälder anzupflanzen. Ist damit eine bessere Anpassung gewährleistet?
Ibisch: Die Maßgabe, Mischwälder anzubauen, gibt es schon lange. Allerdings hat sich die Umsetzung immer schwierig gestaltet, aufgrund von Zwängen ökonomischer Art. Die Holzindustrie fragt bestimmte planbare Sortimente nach, sie hat sich auf bestimmte Durchmesser von Nadelbaumholz, auf bestimmte Eigenschaften für die Konstruktion und Nutzung eingestellt. Mit einem Laubwald lässt sich das nicht gleichermaßen bedienen.
Allerdings ist die Klimawandel in eine derartig kritische Phase eingetreten, dass man sagen muss: Nadelbaumforsten sind keine Option mehr – auch nicht, wenn sie aus „Wunderbäumen für den Klimawandel“ bestehen, die es ohnehin nicht geben kann.
Behörden Spiegel: Können Sie das genauer erklären?
Ibisch: Der Klimawandel ist komplexer als viele denken. Wir entdecken immer noch neue Mechanismen, die die Erderwärmung beschleunigen und die Wälder schädigen. Es wird auch nicht einfach nur wärmer. Kürzlich wurde zum Beispiel belegt, dass die Bewölkung erheblich zurückgegangen ist. Das ist beunruhigend, weil dadurch wesentlich mehr Sonnenenergie auf die Erdoberfläche gelangt. Die Hitze wird größer, gleichzeitig fehlt der Regen. Niederschlag fällt an wenigen Tagen als Starkregen, und nützt dem Wald weniger. Die Volatilität des Klimas nimmt zu. Wenn die Temperatur ansteigt, nimmt parallel die austrocknende Wirkung der Luft exponentiell zu. Hitze, Trockenheit und Vegetationsschädigung verstärken sich gegenseitig.
Wenn man das alles ernst nimmt, müssten unsere Wälder längst anders aussehen. Aber das verträgt sich nicht mit einer intensiven Holznutzung. Wo jetzt Bäume neu gepflanzt werden, brauchen sie Jahrzehnte, um groß zu werden – wenn sie überhaupt anwachsen.
Behörden Spiegel: Was raten Sie kommunalen wie privaten Waldbesitzern?
Ibisch: Angesichts der Klimakrise empfehle ich einen schonenden Umgang mit dem Ökosystem. Wichtig ist, die Struktur des Waldes so zu belassen, wie sie ist, keine Strukturen entfernen, die Schatten spenden oder zur Kühlung und Wasserrückhaltung beitragen. Wenn große Löcher ins Kronendach geschlagen werden, wird es noch schneller kritisch. Totholz sollte im Wald verbleiben, denn es trägt erheblich zur Bodenbildung und zur mikroklimatischen Pufferung bei.
Behörden Spiegel: Sind die Bewirtschaftungsregeln in den Forstverwaltungen denn an die klimatischen Erfordernisse angepasst oder sehen Sie hier Nachbesserungsbedarf?
Ibisch: Die Bewirtschaftungsregeln orientieren sich schon an überkommenen Nachhaltigkeitsvorgaben. Früher ging es vor allem darum, nicht mehr aus dem Wald herauszunehmen als nachwachsen kann. Es wäre schön, wenn wir erst einmal das wieder hinbekämen. Denn im Moment ist es so, dass z. B. von der Fichte mehr Holz geerntet wird als nachwächst. Ein zeitgemäßes Nachhaltigkeitsversprechen bedeutet, dafür zu sorgen, dass sich der Wald weiterentwickelt und auch in der Klimakrise nicht massiv an Resilienz und Resistenz verliert. Je heißer es wird, je mehr Extremwetterereignisse auftreten, desto mehr Holz braucht der Wald für sich selbst.
Es gibt im Rahmen des vom Bund aufgelegten „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz“ schon wichtige Förderprogramme, die eine wald- und klimafreundliche Bewirtschaftung fördern. Es geht nicht alles auf einmal: Jede Menge Holz aus dem Wald holen und gleichzeitig Klima und Ökosystem schützen.
Behörden Spiegel: Ist der Katastrophenschutz, die Waldbrandbekämpfung ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet?
Ibisch: Beim waldbezogenen Katastrophenschutz gibt es noch Defizite. Wir haben wir vor allem in den Kieferforsten im Nordosten Deutschlands eine hohe Waldbrandgefahr. Zwar wurde auch schon einiges in die Früherkennung investiert, aber ich würde mir wünschen, dass noch systematischer Risiken kartiert und konkrete Pläne für den Ernstfall gemacht werden. Dabei ist neben dem Waldbrand auch der Schutz vor weiteren Katastrophen relevant, z. B. vor Überflutungen infolge von Starkregen.
Behörden Spiegel: Mit welchen langfristigen Veränderungen durch den Klimawandel rechnen Sie?
Ibisch: In ganz Deutschland sehen wir schon,wie es aussieht, wenn zuvor häufige Baumarten absterben und die Waldeigentümer große Flächen kahlräumen. Bislang sind es vor allem die Fichten, ausfallen. Aber auch den Kiefern und anderen Arten wird es hier irgendwann zu heiß. Es gibt sehr beunruhigende Schreckensszenarien, mit denen wir rechnen müssen. Aber das muss uns anspornen, den Klimaschutz beherzter anzugehen. Das, was wir bisher tun, reicht schlicht nicht aus – weder in der Landwirtschaft noch in der Forstwirtschaft oder in anderen Sektoren. Wenn die Klimakrise ungebremst weiterläuft, wie es sich jetzt abzeichnet, reden wir am Ende des Jahrhunderts nicht mehr über Forstwirtschaft. Dann reden wir über vieles nicht mehr, was uns jetzt normal erscheint. Das gilt es mit allen Mitteln zu vermeiden.



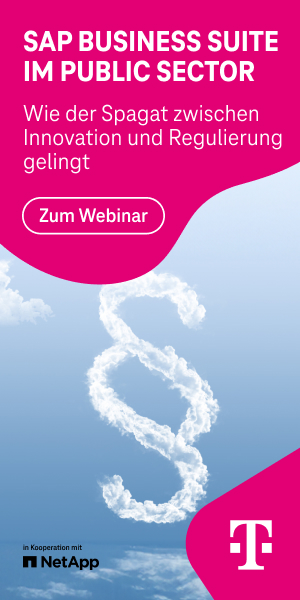



Vielen Dank für Ihre Hinweise und den weiterführenden Link!
Danke für den sehr guten Artikel. In Mittelfranken sehen wir massive Schädigungen unserer Wälder. Es wird höchste Zeit, dass wir darauf reagieren.
Prof. Ibisch hat ja so recht!: Siehe dazu: Presseerklärung der Waldschutzgruppe Münsterland zu den Buchenfällungen in FFH- und Naturschutzgebieten
Mit Entsetzen hat die Waldschutzgruppe Münsterland bei einer Versammlung zur Auswertung der Teilnahme an der Artenschutzkonferenz in Münster
im Cafe‘ Arte in Havixbeck den Artikel zu den Buchen im FFH-Gebiet „Kestenbusch“ zur Kenntnis genommen. Er reiht sich ein in eine wohl konzertierte Kampagne der Holz- und Forstlobby gegen die Weltnaturerbe-Bäume der UNESCO, die Buchenwälder Deutschlands…… https://www.facebook.com/photo?fbid=9932987146758299&set=gm.1676841720371066&idorvanity=1077418446980066