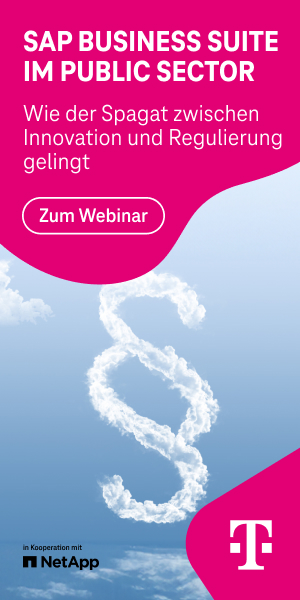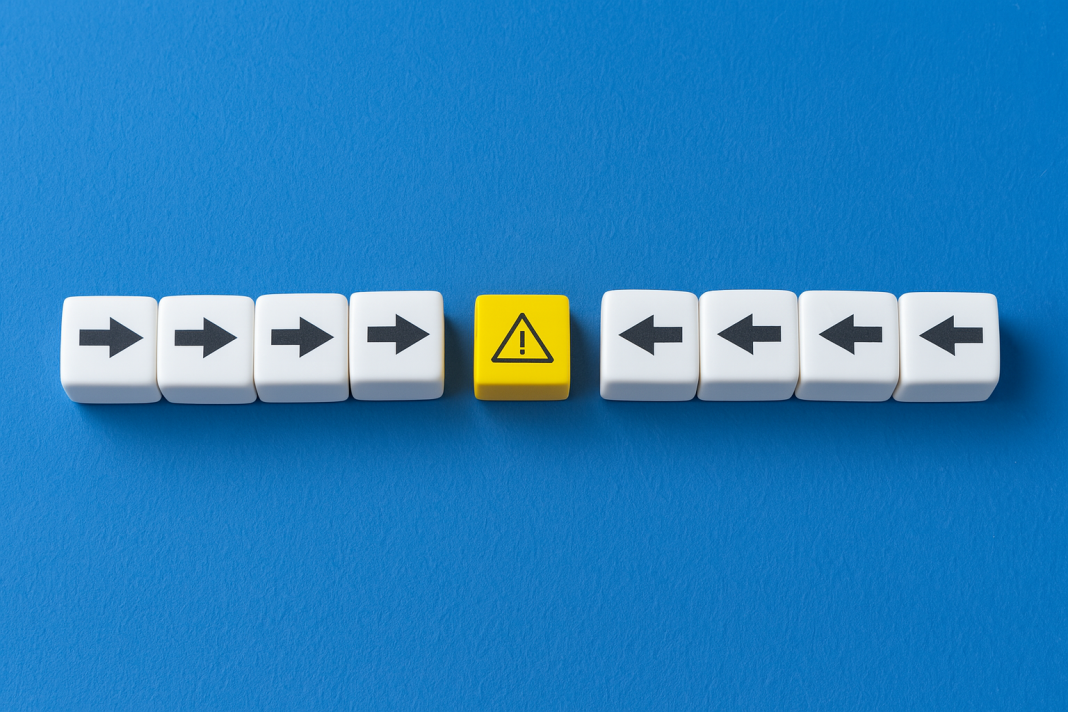Ob Nebentätigkeiten, persönliche Beziehungen oder Aktivitäten während der Freizeit: Die Frage, wann und wie sich private Umstände auf die Tätigkeit am Arbeitsplatz auswirken, ist nicht neu. Vielfach werden hierfür in Unternehmen (strenge) Compliance-Richtlinien etabliert, um die Belegschaft hinreichend zu sensibilisieren.
Im Öffentlichen Dienst kommen die restriktiven gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben hinzu, auch wenn es keine flächendeckenden Compliance-Richtlinien gibt. Durch die digitalen Medien liegen auch nur vermeintliche Verfehlungen häufig direkt unter einem Brennglas, sodass hohe Sorgfalt geboten ist. Mitarbeitende, die sich an die Vorgaben nicht halten, riskieren arbeitsrechtliche Sanktionen hin bis zur Kündigung.
Typische Konstellationen eines Interessenkonflikts
Ersichtlich problematisch ist zunächst die Annahme finanzieller oder sonstiger Vorteile. Gemäß Paragraf 3 Abs. 2 S. 1 TVöD bzw. Paragraf 3 Abs. 3 S. 1 TV-L dürfen Beschäftigte Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit daher grundsätzlich nicht annehmen. Gegebenenfalls ist ansonsten gemäß Paragrafen 331, 332 StGB sogar die Grenze zur Strafbarkeit überschritten. Als unvereinbar mit Paragraf 3 Abs. 3 TV-L erachtete das LAG Hamm nachvollziehbarerweise etwa Einladungen zu Reitturnieren nach Katar in Begleitung des Ehepartners und unter Übernahme von Hotel- und Flugkosten der Business-Class (vgl. LAG Hamm (Westfalen), Urteil vom 14. März 2019 – 11 Sa 980/18). Nach Auffassung des Gerichts wog der damit zusammenhängende Vertrauensbruch so schwer, dass die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt war.
Kritisch ist es ferner, wenn Beschäftigte Amtshandlungen vornehmen müssen, die sie selbst oder ihre Angehörigen betreffen würden. Hier finden sich einige gesetzliche Regelungen, die in diesen Fällen eine Befreiung von den entsprechenden Amtshandlungen vorsehen (für Beamtinnen und Beamten z.B. Paragraf 65 Abs. 1 BBG, Paragraf 47 Abs. 1 LBG NRW, Paragraf 49 LBG Berlin). Damit wird bereits vor Vornahme der Amtshandlung ausgeschlossen, dass sich ein etwaiger Interessenkonflikt in der Entscheidung niederschlägt.
Interessenkonflikte drohen typischerweise auch, wenn eine Nebentätigkeit bereits auf den ersten Blick eng mit der Tätigkeit im Öffentlichen Dienst verknüpft ist. Dies ist beispielsweise anzunehmen, wenn der als Niederlassungsberater einer kassenärztlichen Vereinigung (Körperschaft des öffentlichen Rechts) beschäftigte Mitarbeiter eine entgeltliche Nebentätigkeit in der Arztpraxis seiner Lebensgefährtin aufnehmen will, die später in seinen Zuständigkeitsbereich fällt (vgl. BAG, Urteil vom 19. Dezember 2019 – 6 AZR 23/19). Ein weiteres Beispiel ist die Absicht eines Arbeitnehmers im Bauamt, einer Nebentätigkeit bei einem befreundeten Architekten nachzugehen, der im Gemeindegebiet ein Büro für Bauwesen betreibt (vgl. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 5. Mai 2023 – 12 Sa 11/22).
Bei Beamten bedürfen Nebentätigkeiten regelmäßig der vorherigen Genehmigung (z.B. Paragraf 99 BBG, Paragraf 49 LBG NRW). Für Angestellte des Öffentlichen Dienstes gilt demgegenüber etwa gemäß Paragraf 3 Abs. 3 TVöD oder Paragraf 3 Abs. 4 TV-L (nur) eine Anzeigepflicht. Es obliegt dann der Dienststelle, die Nebentätigkeit zu untersagen oder mit Auflagen zu versehen, wenn diese geeignet ist, die berechtigten Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.
Relevant ist die Ausübung einer Nebentätigkeit nicht nur, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten tatsächlich beeinträchtigt wird, sondern auch dann, wenn eine Beeinträchtigung erfolgen „kann“ (z.B. Paragraf 99 Abs. 2 BBG, Paragraf 49 Abs. 2 LBG NRW) bzw. die Nebentätigkeit zu einer Beeinträchtigung „geeignet ist“ (z.B. Paragraf 3 Abs. 3 S. 2 TVöD, Paragraf 3 Abs. 4 S. 2 TV-L). Das Verständnis relevanter Interessenkonflikte ist vor dem Hintergrund des notwendigen Schutzes der Integrität des Öffentlichen Dienstes weit zu fassen. So kommt es beispielsweise nicht darauf an, ob Nebentätigkeiten und daraus geflossene Zahlungen die betreffenden Beschäftigten tatsächlich dazu veranlasst haben, die zahlenden Drittfirmen bei der Auftragsvergabe zu bevorzugen. Vielmehr genügt nach der Rechtsprechung der nach außen entstandene Eindruck von Schmiergeldzahlungen (vgl. BAG, Urteil vom 18. September 2008 – 2 AZR 827/06).
Vorsicht auch in Graubereichen
Nicht jeder Interessenkonflikt ist ohne Weiteres eindeutig erkennbar. Näher in den Blick zu nehmen sind etwa gerade bei Spitzenämtern häufig vorkommende private Referententätigkeiten für Unternehmen und Verbände. Teils werden diese von der Dienststelle – auch zur Reputation der jeweiligen Behörde – durchaus unterstützt. Gegen die Zulässigkeit einer solchen Nebentätigkeit wird häufig der Einwand geführt, dienstliche Informationen würden unzulässig verwertet und nach außen entstehe der Eindruck, der Haupttätigkeit werde nur untergeordnet nachgegangen. Allerdings kann die Tätigkeit als Seminarleiter auch als besonderes Engagement verstanden und mit einer besonderen Kompetenz assoziiert werden (vgl. VG Bremen, Gerichtsbescheid vom 11. Oktober 2022 – 6 K 2198/19). Zudem gilt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit auch bei der Ausübung einer Nebentätigkeit (vgl. VG Neustadt a.d. Weinstraße, Urteil vom 24. Juli 2018 – 1 K 225/18.NW), sodass auf diese Weise ein Schutz interner Informationen zumindest rechtlich gegeben ist. Insbesondere bei geringer zeitlicher Beanspruchung begründet eine Referententätigkeit daher regelmäßig noch keinen Interessenkonflikt, sofern nicht konkrete Umstände des Einzelfalls einen solchen nahelegen.
Problematisch wird es aber dann, wenn ein unmittelbarer finanzieller Zusammenhang zur dienstlichen Aufgabe besteht. Ein Beispiel ist etwa eine Schulung für ein Unternehmen, das später einen Antrag auf Fördermittel bei der Behörde der vortragenden Person stellt. Gleiches könnte gelten, wenn an das entsprechende Unternehmen öffentliche Aufträge vergeben werden. Eine pauschale Einordnung als Interessenkonflikt ist nicht möglich. Letztlich bedarf es einer konkreten Einzelfallbetrachtung. Ergibt sich erst nachträglich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, ist die Genehmigung für Beamte zu widerrufen (z.B. Paragraf 99 BBG, Paragraf 49 LBG NRW, Paragraf 83 LBG RLP). Bei Angestellten des Öffentlichen Dienstes kann die Nebentätigkeit untersagt werden (Paragraf 3 Abs. 3 S. 2 TVöD, Paragraf 3 Abs. 4 S. 2 TV-L). Demnach liegt die Verantwortung grundsätzlich beim öffentlichen Arbeitgeber, zumindest soweit dieser Kenntnis von allen maßgeblichen Umständen bei Genehmigung bzw. fehlender Versagung der beantragten bzw. angezeigten Nebentätigkeit hatte. Solange er nicht tätig wird, werden Beschäftigte regelmäßig davon ausgehen dürfen, zur Ausübung der Nebentätigkeit (weiterhin) berechtigt zu sein. Im Umkehrbeschluss bedeutet dies aber auch, dass Beschäftigte dazu angehalten sind später eintretende Umstände unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Korrekter Umgang mit Interessenkonflikten
Sodann stellt sich die Frage, wie mit Interessenkonflikten umzugehen ist. Bewährt hat sich in vielen Fällen ein Vier-Augen-Prinzip für bestimmte Entscheidungen einzuführen oder Vertretungsregelungen zu etablieren. Grundsätzlich denkbar sind aber auch weiterreichende Maßnahmen für die jeweiligen Beschäftigten mit Interessenkonflikt. Bei anhaltenden persönlichen Verflechtungen kann beispielsweise eine Versetzung in Betracht kommen. Wer (mehrfach) pflichtwidrig agiert, riskiert auch den Ausspruch einer gerechtfertigten Kündigung.
So ist etwa die Annahme von Belohnungen oder Geschenken in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit regelmäßig geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen (vgl. LAG Düsseldorf, Urteil vom 3. Februar 2012 – 6 Sa 1081/11; BAG, Urteil vom 15. November 2001 – 2 AZR 605/00). Gleiches gilt für die jahrelange Ausübung einer offensichtlich nicht genehmigungsfähigen Nebentätigkeit (vgl. BAG, Urteil vom 18. September 2008 – 2 AZR 827/06). Einen an sich geeigneten wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung hat das BAG ferner im Verstoß gegen das in Paragraf 20 VwVfG normierte Verbot für Beschäftigte gesehen, in Angelegenheiten tätig zu werden, die sie selbst oder ihre Angehörigen betreffen (vgl. BAG, Urteil vom 26. September 2013 – 2 AZR 843/12).
Obwohl die Integrität des Öffentlichen Dienstes einen wesentlichen Aspekt der Interessenabwägung darstellt, ist es unerlässlich, die Umstände des Einzelfalls und insbesondere das Ausmaß des möglichen Interessenkonflikts in den Blick zu nehmen.
Sensibilisierung der Belegschaft
Dadurch, dass die Grenze zu einem relevanten Interessenkonflikt nicht immer klar erkennbar ist, ist vielen Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes oftmals nicht vollumfänglich bewusst, welche für sie alltäglichen Situationen zu potenziellen Interessenkonflikten führen können. Um solchen und damit auch einer Schädigung der Integrität des Öffentlichen Dienstes präventiv entgegenzuwirken, muss die Belegschaft entsprechend sensibilisiert werden. Hierzu eignen sich etwa Schulungen und klare Verhaltensregeln wie Compliance-Richtlinien, die gemeinsam mit dem Personalrat vereinbart werden sollten. Je transparenter der Umgang mit Interessenkonflikten ist, desto weniger wird das Vertrauen in die Sachlichkeit und Neutralität des Öffentlichen Dienstes geschwächt. Die Transparenz beginnt dabei bei den Beschäftigten selbst. Gehen sie transparent mit möglichen Interessenkonflikten um und melden diese frühzeitig, können geeignete Maßnahmen getroffen werden, um diese auszuräumen.
Der Autor dieses Gastbeitrages ist Dr. Michel Hoffmann, LL.B. von der Küttner Rechtsanwälte Partnergesellschaft