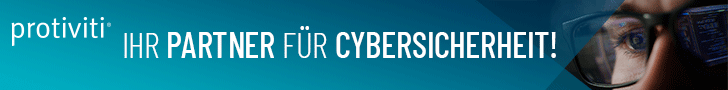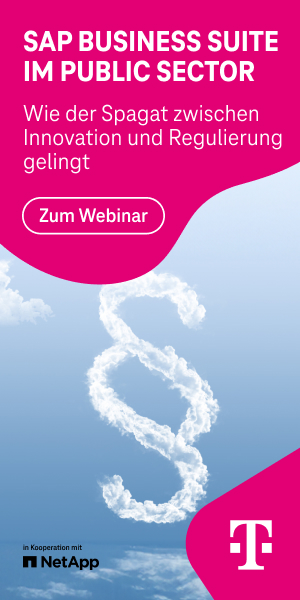„2030 ist bereits zu spät“, stellte General Chris Badia, Deputy Supreme Allied Commander Transformation, auf der Berlin Security Conference 2024 fest. Gemeint ist damit die Entwicklung von Deep-Precision-Strike-Fähigkeiten in der NATO.
Wie Brigadegeneral Corinne Lonchampt, Direktorin für Westeuropa und Nordamerika in der französischen Rüstungsdirektion, feststellt, macht der Ukraine-Krieg deutlich, dass die etablierten Vorstellungen von Fähigkeiten überkommen sind. Rein defensives Vorgehen genügt nicht länger, um eine adäquate Verteidigung zu gewährleisten. „Wir müssen auch über offensive Fähigkeiten nachdenken“, forderte Lonchampt resultierend. Die daraus folgenden Entwicklungsvorhaben müsse man auf viele europäische Schultern verteilen. Deshalb habe Frankreich beschlossen, sich dem Entwicklungsprojekt European Long-Range Strike Approach (ELSA) anzuschließen. Dabei handelt es sich um ein gemeinschaftliches Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben. Auf dem NATO-Gipfel in Washington schlossen sich Polen, Deutschland und Italien der französischen Initiative an. Ziel von ELSA ist es, Raketen mit Reichweiten von mehr als 1.000 Kilometern in hoher Stückzahl zu produzieren.
Den Krieg zum Aggressor tragen
Der Anspruch, Deep-Precision-Strike-Fähigkeiten zu entwickeln, ist den Partnern bei ELSA allerdings nicht exklusiv. Die kleine Nation Estland mit ihren 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern stellt die Beschaffung von reichweitenstarken Raketen in den Mittelpunkt ihrer verteidigungspolitischen Entwicklungsbemühungen.
Obwohl die estnische Wirtschaft klein ist, kommt dabei eine nennenswerte Summe zusammen. Annähernd 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird Estland in den kommenden Jahren voraussichtlich in seine Verteidigung investieren. Dass man sich zu diesem Schritt gezwungen fühlt, liegt laut Magnus-Valdemar Saar, Generaldirektor des Estnischen Zentrums für Verteidigungsinvestitionen, in der Bedrohung durch den größten Nachbarstaat Russland begründet. Im Bereich der Luftverteidigung und weitreichenden Raketen ist Russland der NATO voraus. Falls es zu einem Angriff kommt, müsse die NATO in der Lage sein, von Beginn an den Krieg auch über die Grenzen des Aggressors hinaus zu tragen. Denn die Produktivitätslücke sei gleichzeitig eine Abschreckungslücke. Allerdings, so führte Saar weiter aus, dürfe man sich nicht allein auf Masse und Kosteneffizienz verlassen.
Russland werde sich ausgiebig mit den westlichen Waffen befassen, die zurzeit in der Ukraine zum Einsatz kommen. Deshalb sei es entscheidend, dass die NATO ihren technologischen Vorsprung bewahre und weiter in Entwicklung investiere.
Guido Brendler, Director Sales Business Development bei MBDA, bemühte eine mittelalterliche Analogie, um das Wesen der europäischen Verteidigung zu beschreiben. Die westlichen Luftverteidigungssysteme stellen in diesem Sprachbild die Rüstung eines mittelalterlichen Ritters dar. Lediglich gegen Stiche und Hiebe geschützt zu sein, genüge dem mittelalterlichen Ritter allerdings nicht. Es bedürfe gleichzeitig offensiver Fähigkeiten, eines Speers, um innerhalb des Sprachbildes zu bleiben, um gegen Angriffe wirken zu können – beispielsweise, um Versorgungsketten und die Logistik zu unterbrechen.
Des Weiteren legte Brendler einen Plan vor, der seiner Ansicht nach notwendig sei, um in den neuen sicherheitspolitischen Realitäten zu bestehen. Dazu zähle die Entwicklung hochentwickelter Deep-Precision-Strike-Fähigkeiten mit hoher Überlebensfähigkeit. Diese gelte es finanziell effizient in hoher Stückzahl zu produzieren. Als orchestrierendes Element solle dabei die Maritime Development Division (MDD) auftreten.
Planung für die Gefahren von morgen
Für die NATO ist der Bedarf, präzise militärisch in die Tiefe wirken zu können, längst erkannt. Sie nimmt dafür allerdings nicht nur die gegenwärtige Sicherheitslage zum Maßstab. Die Verteidigungsplanung der NATO werfe den Blick nicht auf die Gefahren von heute, sondern auf die von morgen, stellte Badia klar.
Plane man nämlich mit den Bedrohungen von heute, stünde man in einem kommenden Konflikt technisch im Hintertreffen. „Wir müssen uns an der Dynamik der Bedrohung auf der Zeitachse orientieren“, forderte Badia deshalb. Anspruch der NATO sei die Abschreckung und damit das Aufrechterhalten der technischen Überlegenheit. Abschreckung stelle dabei keine Bedrohung dar. Ihr Zweck sei es, die Kostenabwägung eines potenziellen Angreifers so zu manipulieren, dass er von einer militärischen Aggression absieht.
Klar sei aber auch: Wenn die NATO von Deep-Strike-Fähigkeiten spricht, sind damit immer konventionelle Fähigkeiten gemeint.