Die Cannabis-Legalisierung ist in erster Linie eine Frage der gesellschaftspolitischen Steuerung, die zugleich ordnungspolitische Probleme aufweist. In der überaus kontrovers geführten Debatte wurde der Öffentliche Dienst bislang außer Acht gelassen. Dabei finden sich im Cannabiskontrollgesetz beispielsweise spezielle Regelungen für die Liegenschaften der Bundeswehr. Aber auch hinsichtlich besonderer Beamtengruppen, die z. B. Waffenträger sind oder eine dienstliche Fahrerlaubnis besitzen, lohnt sich ein genauerer Blick.
Die Legalisierung von Cannabis wurde politisch und medial ausgiebig diskutiert. Dabei wurden die Standpunkte zu medizinischen, gesellschaftlichen und juristischen Problemstellungen ausgetauscht. In der Debatte wurde aber nicht berücksichtigt, dass es auf spezielle Berufsgruppen innerhalb der Beamtenschaft, namentlich Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, besondere dienstrechtliche Auswirkungen aufgrund der Cannabis-Legalisierung geben könnte. Ursprünglich erhoffte sich der Gesetzgeber nämlich, durch die Entkriminalisierung des Besitzes von Cannabis die stetige Zunahme des Konsums in Deutschland einzudämmen, den „Schwarzmarkt“ einzuhegen und den Schutz der Konsumenten zu verbessern. Im Ergebnis sollten Polizei und Justiz entlastet werden.
Zusammen mit dem Cannabiskontrollgesetz (KCanG) wurde eine Reihe von Gesetzen geändert. Das neue KCanG regelt den legalen Besitz und den Konsum von bis zu 25 Gramm Cannabis sowie den Besitz von Cannabispflanzen. Daneben werden durch das KCanG Örtlichkeiten festgelegt, wo der Konsum von Cannabis verboten ist.
Dienstrechtliche Aspekte
Isoliert betrachtet steht nun auch dem Polizeivollzugsbeamten das Recht zu, Cannabis zu konsumieren. Im Zusammenspiel mit den dienstrechtlichen Verpflichtungen des Beamten gibt es jedoch gewisse Einschränkungen. Auf der Hand liegt, dass der Dienstherr den Konsum von Cannabis innerhalb der Dienstzeit reglementieren kann. Komplizierter gestaltet sich eine Reglementierung des Cannabiskonsums in der Freizeit des Beamten. Bisher stellten Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis außerhalb des Dienstes regelmäßig eine Straftat dar und somit einen Verstoß gegen die beamtenrechtliche Wohlverhaltenspflicht. Nach der neuen Rechtslage fällt jedoch die schuldhafte Begehung einer Dienstpflichtverletzung weg, sofern der Beamte im Rahmen des Erlaubtem nach dem KCanG handelt.
Nichtsdestotrotz können durch den Konsum andere Dienstpflichten betroffen sein. In erster Linie ist an die Pflicht zur Gesunderhaltung zu denken, welche sich aus der „Pflicht, sich dem Beruf mit vollem persönlichem Einsatz zu widmen“, ableitet. Der alleinige Konsum von Betäubungsmitteln und die Gefahr, abhängig zu werden, stellen für sich zwar noch kein ernsthaftes Problem dar. Jedoch können die aus einem Konsum folgenden pflichtwidrigen Verhaltensweisen und Folgen im Ergebnis ein dienstpflichtwidriges Verhalten ausmachen. Sofern ein Beamter abhängig ist, stellt sich die Frage, ob er der „Pflicht zur Wiederherstellung der Gesundheit“ unterworfen ist. Bei alkoholabhängigen Beamten ist mittlerweile anerkannt dass ihnen ihr Dienstherr ein absolutes Alkoholverbot auferlegen darf. Es steht zu vermuten, dass dies für cannabisabhängige Beamte gleichermaßen gelten wird.
Handlungsbedarf
Ein besonderes Augenmerk ist auf Waffenträger und die sich in diesem Kontext aufdrängende Frage zu legen, welche Auswirkungen der außerdienstliche Cannabiskonsum auf die Fähigkeit zum Führen von Dienstwaffen hat. Eine ähnliche Fragestellung dürfte sich mit Blick auf die Nutzung von Dienstfahrzeugen stellen.
Sodann bieten sich dem Dienstherren verschiedene Möglichkeiten, mit den neuen Regelungen des KCanG umzugehen. Die erste Option ist, keine besonderen Regelungen zu treffen. Dies würde im Ergebnis bedeuten, dass der Dienstherr den Cannabiskonsum dem Konsum von Alkohol gleichstellt und nur eingreift, wenn Auswirkungen auf den Dienst festgestellt werden.
Eine zweite Handlungsalternative ist die Regelung durch eine Verwaltungsvorschrift. Sofern der Dienstherr nur die innerdienstlichen Angelegenheiten und Verhaltensweisen der Beamten regeln will, dürfte dies unproblematisch sein. Bei einer Regelung, die den außerdienstlichen Lebensbereich der Beamtenschaft betrifft, könnte dies aufgrund der Eingriffsintensität einer solchen Regelung jedoch in Konflikt mit dem erfassungsrechtlichen Vorbehalt des Gesetzes stehen.
Schließlich bliebe dem Dienstherren noch die Möglichkeit, eine Regelung durch ein Gesetz herbeizuführen. Auf diese Weise könnte auch der außerdienstliche Konsum reglementiert werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit könnte es sich anbieten, hierbei zwischen einzelnen Beamtengruppen zu differenzieren. So wären insbesondere bei den Beamtengruppen, die gefahrengeneigte Tätigkeiten ausüben, tiefgreifendere Maßnahmen statthaft.
Am Ende bleibt ein differenziertes Bild, welches nach einer ausdifferenzierten Lösung verlangt. Dem Dienstherrn bleiben dabei verschiedene Konzepte zur Problemlösung. Die Schaffung von innerdienstlichen Verbotsnormen sowie einer gesetzlichen Reglementierung des Konsums außerhalb des Dienstes dürften jedoch für ein gewisses Maß an Rechtssicherheit sorgen.
Die Autoren des Gastbeitrags sind Prof. Dr. Harald Bretschneider, Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, und Dominik Lambiase, M. A., Polizeirat bei der Bundespolizei und Leiter eines Lehrbereichs eines Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums.



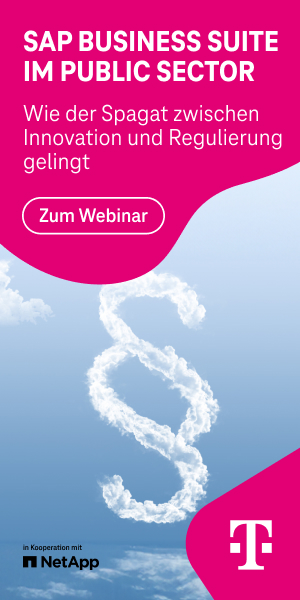



Danke für die Kommentare Weerth, spart mir viel tipperei!! Der Artikel war zum fremdschämen!
Der Artikel offenbart einige grundlegende Missverständnisse bezüglich der rechtlichen und faktischen Dimension der Cannabis-Legalisierung im Beamtenrecht. Die Autoren scheinen weniger an einer sachlichen Analyse interessiert zu sein, als vielmehr daran, ein überholtes Narrativ fortzuschreiben, nach dem Cannabiskonsum per se eine dienstliche Belastung darstelle. Diese Position ist rechtlich nicht haltbar. Im Einzelnen:
Die Autoren führen aus, dass ‚bisher Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis außerhalb des Dienstes regelmäßig eine Straftat‘ darstellten. Diese Darstellung verkennt die Systematik des Betäubungsmittelgesetzes fundamental: Der Konsum von Betäubungsmitteln war und ist in Deutschland nicht strafbewehrt. Diese rechtliche Ungenauigkeit ist besonders irritierend, da sie von einem Professor der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung stammt.
Ein weiterer wesentlicher Fehler findet sich in der Gleichsetzung von Cannabis mit Betäubungsmitteln. Nach der eindeutigen Entscheidung des Gesetzgebers ist Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel im Rechtssinne einzustufen, da es nicht in den Anlagen I bis III des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) aufgeführt ist. Diese rechtliche Realität mag man politisch anders bewerten, sie ist jedoch geltendes Recht.
Die im Artikel angedeutete These, Cannabis sei mindestens ebenso gefährlich wie Alkohol, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage – insbesondere im Hinblick auf die relevante Gruppe der erwachsenen Beamtinnen und Beamten. Eine empirische Untersuchung zur Dienstunfähigkeit aufgrund von Cannabis- versus Alkoholkonsum würde diese Einschätzung vermutlich deutlich widerlegen.
Besonders bedenklich erscheint die Forderung nach einer gesetzlichen Reglementierung des außerdienstlichen Cannabiskonsums von Beamtinnen und Beamten. Dies wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in die private Lebensführung. Es ist völlig ausreichend, wenn Dienstherren auf wissenschaftlicher Basis den innerdienstlichen Konsum regeln. Die gesellschaftliche Entwicklung und die daraus resultierende Gesetzesänderung sind zu akzeptieren.
Der Artikel spiegelt leider eine Haltung wider, die sich der sachlichen Auseinandersetzung mit der neuen Rechtslage verweigert. Dies wird weder der Komplexität des Themas noch dem Anspruch des Behörden Spiegels als Leitmedium für den Öffentlichen Dienst gerecht.