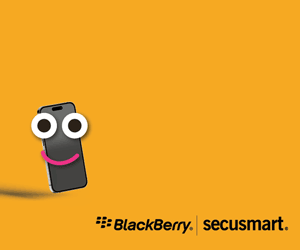Immer mehr wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen und gleichzeitig kaum bezahlbarer Wohnraum: Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) will der Notlage mit dem „Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 2024“ entgegnen. Ein erster Referentenentwurf liegt vor, grobe Ziele sind gesteckt. Doch verspricht das Programm eine Verbesserung der Lage?
Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das die Europäische Union (EU) sich gesetzt hat und das auch Deutschland erfüllen will: Bis zum Jahr 2030 soll die Wohnungslosigkeit in allen Mitgliedstaaten der EU beendet werden. Hierzulande bedeutet das: Bis zur gesetzten Frist soll jeder wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Person das Angebot für eine Wohnung gemacht werden können. Neben einem Wohnungsangebot sollen auch Präventionsmaßnahmen und der Rechtsanspruch auf ordnungsrechtliche Unterbringung im Falle von Wohnungslosigkeit etabliert werden.
Diese Leitlinien bilden die Grundlage für den Aktionsplan, an dem staatliche und nicht-staatliche Akteure beteiligt sind. Vertreten sind hier etwa neben dem BMWSB auf Bundesebene auch die Bauministerkonferenz auf Länderseite, sowie der Deutsche Städtetag (DST) oder der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) für die Kommunen. Die Intention des Aktionsplans wird klar herausgestellt: „Die Leitlinien und Impulsmaßnahmen des Aktionsplans sollen die bestehenden Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen sichtbar machen, an geeigneten Stellen ergänzen und den Wirkungsgrad der Wohnraumversorgung für wohnungs- und obdachlose Menschen erhöhen, um somit Wohnungslosigkeit zu überwinden.“
Grundstein für Erfolg jetzt legen
Grundsätzlich stößt der Entwurf auf positive Resonanz. Dr. Carolin Martin, Expertin für Wohnungsmärkte am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, begrüßt die beschriebenen Maßnahmen, gibt jedoch zu bedenken, dass die Umsetzung Zeit in Anspruch nehmen werde. Martin plädiert für zusätzliche kurzfristig wirkende Maßnahmenpakete, um den kommunalen Wohnungsbau anzukurbeln. Außerdem kritisiert sie, dass aus dem Entwurf nicht deutlich genug hervorgehe, wie das Angebot an bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum ausgeweitet werden solle.
Mit Blick auf den Vorsatz für 2030, die Obdachlosigkeit zu überwinden, stellen sich einige Fragen. Einmal abgesehen davon, dass es durchaus Menschen geben könnte, die das Leben ohne festen Wohnsitz aus Gründen der Selbstbestimmung den staatlichen Angeboten vorziehen und es dadurch auch weiterhin obdachlose Menschen geben dürfte, stellt sich die Frage nach dem Grundstein, der gelegt werden muss. Aktuell prägen Wohnungsmangel, Krisen in der Baubranche und eine wachsende Zahl von Wohnungslosen das Geschehen. Um diese Zustände bundesweit abzuschaffen, bleiben nur wenige Jahre. Allerhöchste Zeit also, um einen ersten Schritt zur Trendwende zu machen? Welche Entwicklungen darf man für das Jahr 2024 erwarten?
„Beim kommunalen Wohnungsbau in Deutschland droht sich der massive Einbruch der Baufertigstellungen auch 2024 wegen der weiterhin hohen Zinsen und Baukosten weiter zu verschärfen“, weiß Martin. Sie befürchtet einen weiteren Kapazitätsabbau der Bauwirtschaft.
Der kommunale Wohnungsbau stehe ebenso wie der bezahlbare Wohnungsbau insgesamt vor enormen Herausforderungen, bestätigt auch Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW). Die aktuellen Bedingungen machten den Bau bezahlbarer Wohnungen unmöglich, führt Gedaschko aus und bemängelt: „Schon seit zwei Jahren hält die Krise beim Wohnungsbau an – ohne, dass die Regierung Gegenmaßnahmen in auch nur annähernd ausreichendem Umfang ergriffen hätte.“ Obwohl Zins- und Baukostenexplosionen sowie Materialengpässe massive Probleme bereiteten, seien durch die Regierung anstelle von Fördergeldern vielmehr Förderstopps bewirkt worden.
Kommunalen Wohnungsbau beleben
Die Wiederaufnahme des kommunalen Wohnungsbaus kann allerdings trotz der bestehenden Schwierigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen gelingen.
Gedaschko schlägt ein kostenfreies und breit angelegtes Zinsprogramm für bezahlbaren Wohnraum vor. Außerdem fordert er Quartierslösungen für den jeweils passenden Klimaschutz-Mix vor Ort, anstelle pauschal an verschärften Energieeffizienzstandards festzuhalten, sowie Bürokratieabbau und vereinheitlichte Landesbauordnungen. Baugenehmigungsverfahren sollten ebenfalls vereinfacht werden. Gedaschko konstatiert: „Keine überzogenen Standards und deutlich mehr Förderung – nur so schafft Deutschland den Weg aus der Wohnungsbau-Krise.“
Hilfreich sei aus Gedaschkos Sicht auch Sonderförderungen durch Bundes- und Landespolitik, denn jährlich würden rund 23 Milliarden Euro an Subventionen benötigt, von denen 15 Milliarden Euro auf neue Sozialwohnungen entfielen und 8 Milliarden auf den Neubau bezahlbarer Wohnungen. Auch Martin von der Hans-Böckler-Stiftung sieht Möglichkeiten, um den kommunalen Wohnungsbau zu beleben. Eine Erweiterung des kommunalen Vorkaufsrechts, auch für Bodenvorratspolitik, sei sinnvoll, ebenso wie die Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwicklungsrechts, ein Bodenfonds auf Länderebene zur Unterstützung des kommunalen Bodenerwerbs oder eine Erhöhung bestehender KfW-Programme zum Wohnungsbau